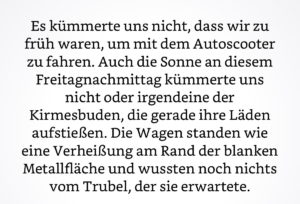„We used to get our kicks reading surfing magazines / Wake up on the morning and the waves are clean / Standing on the headland taking in the scene / Just like they do it … In surfing magazines“ (The Go-Betweens)
Wieviele Surfer kenne ich eigentlich? Klaus S. aus meiner alten Schulklasse spielte nicht nur am besten Akustikgitarre, er ist, glaube ich, auch öfter zur holländischen Küste zum Surfen gefahren. Aber wie weit war Scheweningen von Santa Monica entfernt, über die Wellen sprechen wir erst gar nicht. Es waren eher symbolische Akte, aber überall lief die gleiche Musik, Underground und Overground. Mit Thomas W. vom Kammerflimmer Kollektief teile ich die Faszination am Surfen: zu gerne würden wir eine kleine Zeitreise in die späten Sechziger antreten, und in einschlägigen kalifornischen Surfmekkas ein paar alternative Lebensläufe am Rande sechs Fuss hoher Brecher erproben, inklusive Wipeout. Und hawaianischem Brudaar!
Tja, „Wipeout“, ich bin etwas schlauer geworfen. Ich habe mir einfach ein Buch aus dem Mare-Verlag gegriffen, „Surferboy“, und das endet mit einem seitenlangen Glossar mit Fachausdrücken der Surfersprache. Hab ich sie noch alle? Aber ja, das war die Motivation, lass dir mal so eine kalifornische Jugend erzählen, in der die „big waves“ nur so krachen. Surfin‘ USA. So the wind won’t blow it all away.
Interessanterweise bin ich in den letzten Tagen nicht nur beim Surfen gelandet, sondern auch beim Wrestling, so ungefähr die uninteressanteste Sportart, die ich mir vorstellen kann. Aber John Darnielle von den Mountain Goats ist in seiner Kindheit vom Wrestling-Virus infiziert worden, und in Kürze erscheint sein umwerfendes Konzeptalbum „Beat The Champ“, in dem er diese bizarre Welt in einen hinreissenden Songreigen verwandelt, in dem das Abseitige seine menschlich-allzumenschliche Strahlkraft freilegt. Eines der grossen Songalben des Jahres, und wie er hier auch noch Jazzspuren unterbringt, lässt einen endgültig staunen. Texte wie geschliffenes Glas, Verwundbarkeit, trostlose Motels, Blut, und die Einsamkeit von Kindern in der Vorstadt. Aber ich schweife ab.
Amerikanische Kids träumten vom Surfen weil sie genau in dem Biotop lebten, wo Dick Dale den Ur-Sound des Surfens prägte, wo die Beach Boys die nächste hippieske Welle ins Rollen brachten – selbst introvertierte Träumer wie Jackson Browne machten sich bei diversen „Roadtrips“ auf die Suche nach „moments of excellence“ – „Surfari“ war das Zauberwort. „Too late for the sky?“ Na ja, irgendwann schon.
Es gab damals eine Serie, die wirklich Kult war, und nie zu uns nach Europa rüberschwappte: „The Endless Summer“, zwei „Helden“ suchten nach der perfekten Welle, überall auf der Welt. Und sie fanden diese Riesendinger auch. In diese Welt taucht das alter ego des Schriftstellers Kevin McAleer ein. Am Anfang ist man ein „Kook“, ein Dilettant, ein Greenhorn, das im Wind schnüffelt. Man macht sich leicht lächerlich, Die Cracks ziehen die Show ab, schon die sog. grossen Zeiten taugen als Studienobjekt für dahinsiechende Mythen.
Julia Ritter versucht erst gar nicht, die Welt des Surfens nahtlos ins Deutsche zu übertragen, überall stolpern wir über unübersetzte idiomatische Sprache, aus dem Kontext ergibt sich Sinn, zumindest bruchstückhaft. Eine Verfremdung, die uns gar nicht erst „the real thing“ vorgaukelt. Mit der Zeit kommt das richtig gut. Von wegen: „go with the flow“. Sog und Widerhaken halten die Balance. Das Buch ist klug gebaut. Was anfänglich wie schlichter Stoff für Surfromantiker wirkt, geht dann richtig Bach und Welle runter.
Das wird von Episode zu Episode fesselnder, surreal, witzig, gefährlich, und das Ende von allem: die Moden und der Fundamentalismus. Im schlimmsten Fall toben Machtkämpfe, Freundschaften zerbrechen, aber, fuck, ich hätte zu gerne einmal im Leben die perfekte Welle erlebt, 68, in Malibu Beach.
Stattdessen habe ich heute noch eine genaue Erinnerung daran, wie ich, als Dick Dale an der West Coast tourte, auf dem Schulhof der Brüder Grimm-Schule einen Lederball mit der Brust annahm, und volley ins Tor schoss, knapp neben der rechten Tormarkierung, die durch einen Tornister markiert war. Ein Glücksgefühl ohnegleichen. Mein Held war Reinhold Wosab, der machte es im Stadion Rote Erde ganz ähnlich.
Die perfekte Welle hat viele Gesichter, der Gitarrist Fennesz ist, auf seinem frühen, gewiss nicht besten Album, „Endless Summer“, diesem Feeling nachgegangen, und neben „sweet fragments“ mit Beach Boys-Flair entwickelte er ein Stück Chaostheorie für die elektrische Gitarre. Der angezapfte Mythos hat ihm damals wohl mehr Türen in der Szene geöffnet als die noch unausgereifte Musik voller interessanter Versprechen.
In jedem Land hat die perfekte Welle andere Gesichter, und manche zeigte sich kurz vor Einbruch der Nacht, wenn man in einem Spiel, das nur noch der Erschöpfung und einer gewissen Traumlogik folgte, einen Fussball aus dem fahlen Laternenlicht auftauchen sieht, schemenhaft, und ihn vollkommen sinnlos in den Himmel bolzt. Wir sind alle Sternschnuppen, voller Elan. Aus dem Nichts geschöpft, erfüllte Momente & Wipeout. Und irgendwann singt immer jemand an einem Lagerfeuer in San Diego, gegenüber der Eisdiele am Leicester Square, oder auf dem Kopfsteinpflaster von Leinfelden-Echterdingen, Neil Youngs „Heart of Gold“.
Klaus hat übrigens Ernst gemacht. Er hat immer die weiten Räume gesucht, und sie sich mit seiner Frau, dem Hund und den Bären geteilt. Es gab auch, ganz früh, einen Abstecher in die Mohave-Wüste. In Las Vegas hat der letzte Hippie der OIc geheiratet, und auf der Bühne standen die legendären „Highwaymen“ der Countrymusik, Johnny Cash, Willie Nelson, Kris Kristoffersen, und einen vergesse ich immer. Das grosse Nordamerika hat Klaus nie losgelassen, ihm und Babsi widme ich diese kleinen Abschweifungen, mit Gedanken zum „Surferboy“, entrückten Erinnerungen, Evergreens, und jenen perfekten Tagen, die uns keiner mehr rauben wird. Die Erinnerung kennt keine Tagediebe, höchstens ganz am Schluss, wenn die Endspiele kommen, und die Tränen von einem zum andern wandern. „Tell me why“, Klaus, komm, nimm die Gitarre, spiel es noch einmal, ich singe mit.