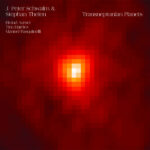„Der Weltraum, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2022. Das sind die Abenteuer von J. Peter Schwalm und Stephan Thelen, die mit einer 4 Mann starken Besatzung unterwegs sind um fremde Galaxien zu erforschen, neues Leben und neue Zivilisationen. Weit von der Erde entfernt dringen sie jenseits des Neptun in fremde Räume vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat“.
Die Sonne ist nur noch ein kleiner heller Punkt im Firmament, die Temperatur nähert sich langsam dem absoluten Nullpunkt an und aus der kosmischen Finsternis nähern sich lichtlose Objekte, Planetoide, langsam den Protagonisten. Zwischen ihnen werden kleine Dateien mit Lichtgeschwindigkeit durch den Äther geschickt, Skizzen, Ideen, Entwürfe, die von dem jeweiligen Empfänger sorgsam gehört und derart bearbeitet wurden, dass daraus etwas entstand, was keiner von beiden je vorher gemacht hatte, was alle gewohnten Muster zerlegte. Dort in der Tiefe des transneptunischen Raumes entstand fern von allen irdischen Einflüssen etwas, das so noch nie zu hören war. Neue Botschaften von fernen Welten.
Mit an Bord waren Eivind Aarset, der Bassist Tim Harries und der Schlagzeuger Manuel Pasquinelli, die sowohl exorbitant ätherische wie rhythmisch treibende Elemente einbrachten. Den Einstieg macht ein Besuch bei Pluto, der erst vor einigen Jahren seinen Planetenstatus verlor und zum Planetoiden herabgestuft wurde. Hier stoßen treibende rhythmische Strukturen auf subtile atmosphärische Elemente, unberechenbar und horizonterweiternd. Mit MakeMake entfalten sich dystopische Eruptionen mit streckenweise fragwürdiger Rhythmusstruktur, die von völlig unvorhersehbaren Wendungen leben. Die nächsten drei Stücke schweben sich langsam entwickelnd zwischen untergründigen archaischen Fragmenten und ätherischem Cyberspace-Dub, teilweise von Eivind Aarsets einzigartiger Weise Gitarre zu spielen über alle Grenzen getragen. GongGong – ja die so fernen Planetoide habe oft obskure Namen – oszilliert zwischen den Polen psychedelischer Klänge und Techno-Trance mit der unterschwelligen Aggressivität eines uralten Reptils, wohingegen die letzten beiden Stücke dann auf ihren exzentrischen Bahnen lichtferne Räume durchmessen, mal lautlos gleitend, filigran sich um die eigene Achse drehend, mal verhalten treibend und gewohnte Patterns sicher umschiffend, um sich letztendlich wie in der Schlussszene eines Science Fiction in unendlichen Weiten zu verlieren.
Im Jahr 2021 arbeitete Stephan Thelen parallel an vier Albumprojekten, die sich in intensiver Weise gegenseitig beeinflussten und bei sehr unterschiedlichen Konzepten und teilweise anderen Musikern aber sehr eigenständige und spannende Klangräume entstehen ließen. In Fractal Guitar 3 finden sich auf den Stücken alle Musiker, die auch auf Transneptunian Planets spielen wieder, zudem u.a. noch Markus Reuter, Jon Durant, Andi Pupato und Stefan Huth. Auf den verschiedenen Alben gibt es Stücke die den gleichen Ansatz haben, wie die polyrhythmische Struktur „5 gegen 7“ die nicht nur bei Morning Star, sondern auch bei Pluto und bei Fractal 5.7 auf dem dritten Album Fractal Sextet jeweils völlig andere Atmosphären entstehen lassen. Es finden sich recyclte Elemente des ersten Sonar-Albums Black Light wieder in Orbit 5.7 und Glitch, dann werden teilweise die komplexen Polyrhythmen in verschiedenen Tonhöhen und Geschwindigkeiten in atemberaubender Eskalation gegeneinander laufen lassen wie in Black On Electric Blue und als Pendant Slow Over Fast auf Fractal Sextet. Umklammert wird Fractal Guitar 3 von dem extremfaszinierenden Stück Through The Stargate, das von Eivind Aarset mitkomponiert wurde und am Anfang einen sehr treibenden Einstieg schafft und zum Schluß in einem sehr atmosphärischen Mix von J. Peter Schwalm, der die schwebenden Gitarrenklänge Aarsets in den Vordergrund hebt und so die tiefe musikalische Verbundenheit der beiden so unterschiedlichen Gitarristen in eine wunderbare Synthese bringt.
Fractal Sextet bringt mit dem Pianisten und Keyboarder Fabio Anile, dem Bassisten Colin Edwards und dem Schlagzeuger und Spezialisten für Polyrhythmen Yogev Gabay ein anderes Spektrum an Musikern auf den Plan, die zwischen minimalistischen Mustern, Prog und Kammerjazz eine atmosphärisch dichte Synthese finden und dabei fast Bandcharakter entwickeln, wenn nicht auch dieses wunderbare Album durch die pandemiebedingten Restriktionen vor allem durch den Austausch von Fragmenten und Dateien entstand. Hier kann man nur hoffen, dass die Musiker für eine Performance eines Tages live zusammenfinden. Doch das ist nicht das Ende dieser Geschichte, da noch ein weiteres Album fehlt …