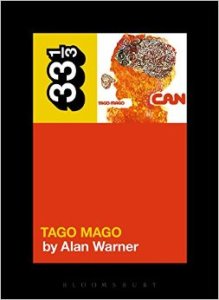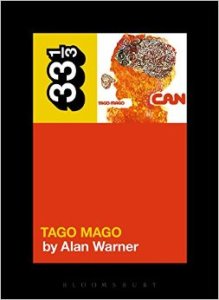
Das Hundegebell in den Stück „Aumgn“ kennen natürlich alle Can-Fans. Nun endlich erfahren wir auch, wer der Urheber war: ein Schnauzer, der auf den Namen Assi hörte (oder manchmal auch nicht) und Irmin Schmidt gehörte.
Die meisten weiteren Informationen, die dieses Buch bietet, sind ähnlich aufregend.
Die Reihe 33 1/3 hängt sich seit je bevorzugt an Klassiker und kommerziell erfolgreiche Alben an; Randerscheinungen des Musikbetriebes fielen zwar nicht völlig unter den Tisch, blieben aber eher die Ausnahme. Mit dem Wechsel der Reihe von Continuum Books zu Bloomsbury scheint sich diese Tendenz verstärkt zu haben, wie ein Blick auf die geplanten kommenden Veröffentlichungen zeigt.
Einen Band über ein Album aus Deutschland suchte man bei den bis jetzt erschienenen 100 Ausgaben vergeblich. Band 101 ist der erste: Alan Warners Buch über Cans Doppelalbum Tago Mago von 1971. Keine schlechte Wahl. Tago Mago hat alle Stürme der Jahrzehnte überdauert, ist musikalisch kaum angreifbar und darf – im Gegensatz zu den meisten Produkten, denen dieses Attribut angehängt wird – ganz sicher als „legendär“ bezeichnet werden.
Was kann man über ein Werk, das seit 43 Jahren nie weg vom Fenster war, noch schreiben? Alan Warner, um es vorwegzunehmen, hat keine überzeugende Antwort gefunden. Natürlich stellt sich diese Frage auch bei anderen Alben der Reihe, und meist beschreiten die Autoren einen der beiden folgenden Wege: Entweder, man nimmt das dem jeweiligen Buch zugrunde liegende Album musikalisch-analytisch oder rezeptionsgeschichtlich auseinander. Das kann klappen (wie etwa im Fall von Geeta Dayals Buch über Brian Enos Another Green World), es kann aber auch theorielastig und kompliziert werden (wie in Don Breithaupts Buch über Steely Dans Aja). Oder, Möglichkeit 2: Man fasst das Album als eine Art Kulisse auf, vor der sich des Autors eigenes, mehr oder weniger interessantes Leben abgespielt hat – wobei dann letzteres das Hauptthema ist. Alan Warners Buch gehört klar in diese zweite Kategorie.
Wer sich also neue Erkenntnisse oder Informationen über Entstehung und Rezeptionsgeschichte von Tago Mago erhofft, tanzt hier auf der falschen Hochzeit. Tago Mago bildet über fast 100 Seiten hinweg bestenfalls den roten Faden; über weite Strecken geht es um Dinge aus Warners Jugend.
Alan Warner wurde 1964 geboren, wuchs irgendwo in der schottischen Provinz auf und war 7, als Tago Mago erschien. Can, das wird schnell deutlich, entdeckte er erst in den 1980er Jahren, als es die Band schon gar nicht mehr gab, und sein Zugang zu ihr waren die Sex Pistols – John Lydon hatte sich über den Can-Drummer Jaki Liebezeit geäußert. Punk- und New-Wave-Bands, eine Reihe von Jazzern und das Leben in der Kleinstadt waren der Kontext, in dem Warner nach Can forschte, und er geht immer wieder auf diesen Hintergrund ein. Einige nette Anekdoten sind darunter – etwa, wie er mit seiner Mutter in einem pieksauberen örtlichen Schallplattenladen eine fehlerhafte Pressung von Ian Durys LP New Boots And Panties!! reklamiert und dann beim Probeabspielen Durys a cappella geröhrte Zeile „Arseholes, bastards, fucking cunts and pricks …“ durch den ganzen Laden tönt.
Tago Mago war nicht einmal das erste Can-Album, das Warner kennengelernt hat, sondern zunächst entdeckte er im Glasgower Virgin Megastore das Can betitelte Album der Band von 1979 (das mit dem Schraubenschlüssel), das sich von den frühen Can-Alben deutlich unterscheidet. Dazu geisterten ihm etliche Mythen und Märchen über deutsche Rockmusiker und ihr Hippietum durch den Kopf, die die britische Musikpresse dort eingepflanzt hatte. So hatte er u.a. gehört, dass die Can-Musiker in einem Schloss leben, und nun malt er sich aus, wie es dort wohl aussieht, ob sie wohl ihr eigenes Gemüse anbauen, und er spekuliert über Malcolm Mooneys Waschgewohnheiten.
Und wenn man dann auf Seite 97 denkt, jetzt komme Warner endlich konkret zu Tago Mago, so irrt man erneut, denn erstmal werden nun die Gegebenheiten im Schloss Nörvenich ausgebreitet (das konsequent als „Norvenich“ bezeichnet wird; die Band hatte dort vier Jahre lang ihr Studio), gefolgt von seitenlangen Überlegungen zu Theorie, Praxis und Mysterien des Tape-Editing. Das ist nicht mal uninteressant, hat aber sehr viel mehr mit Teo Macero und diversen Miles-Davis-Alben zu tun als mit Can. Erst ab Seite 108 liegt dann der Schwerpunkt endlich wirklich auf dem Album Tago Mago. Leider kommt aber auch weiterhin nicht viel dabei herum. Der Autor hat Interviews mit Irmin Schmidt und Jaki Liebezeit geführt, ohne dass dabei irgendwelche neuen Erkenntnisse herausgekommen wären (außer vielleicht die Sache mit Assi). Dass die Band nicht im Schloss gewohnt hat, dass Tago Mago ein Produkt gekonnten Tape-Editings ist, dass die Stücke keineswegs in nur einem Durchgang aufgenommen wurden, und dass es Irmin Schmidts Frau Hildegard (Cans Managerin) zu verdanken ist, dass Tago Mago ein Doppelalbum wurde – das alles weiß man längst. Warners Sicht- und Beschreibungsweise ist dabei weitgehend deskriptiv, musikalische Analysen sucht man ebenso vergeblich wie eine Beschreibung der damaligen Lebens- und Arbeitsumstände der Musiker.
Es ist anscheinend wirklich schon alles über das Album gesagt worden, nur noch nicht von allen. Mit diesem Buch ist der Chor um eine (immerhin gut geschriebene) Stimme reicher, aber das ist dann auch alles. Für ein ganzes Buch ein bisschen zu wenig, als Lektüre am Strand oder während einer Bahnfahrt lohnt es sich aber, zumal es gut in die Jackentasche passt. Und wenn die Lektüre dazu führt, dass man sich das Album einmal wieder zu Gemüte führt, dann hat das Buch seinen Zweck erfüllt.
Alan Warner: Tago Mago. Bloomsbury Academic 2015.
142 Seiten. ISBN 978-1-62892-108-3.
(An English version of this review is to be found here!)