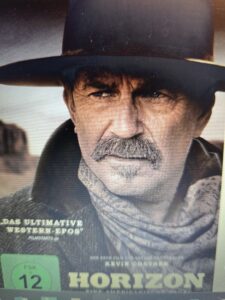Die Haut in der ich wohne (Spanien, 2011) von Pedro Almodóvar
… die passt einem manchmal verdammt schlecht, diese Pelle, als Topos des Spürens, der Lust, der Abgrenzung, der Verletzung, des Schutzes und der Scham, viel mehr als nur eine Folie von aneinanderhängenden Eiweissverbindungen – und ein Thema mit dem der grosse Alte sicher etwas anzufangen wusste beim Aufwachsen als Schwuler im ländlich – katholischen und faschistischen Spanien, da möchte man sicher öfter aus derselbigen fahren und erhofft sich mit einem Wechsel des Körpers auch einen Wechsel unwillkommener oder gesellschaftlich nicht akzeptierter Bedürfnisse. Aber wer kann schon aus seiner Haut?
Den Körper sukzessive in einer quälenden Prozedur durch Hautverpflanzung stückchenweise zu verändern ist auch das Thema dieses Films; die Protagonisten scheinen in ein seltsames sadomasochistisches Beziehungsgeflecht verwoben in dem libidinöse und aggressive Bestrebungen untrennbar verschmolzen scheinen. Ein Chirurg, der sich mit Hauttransplantationen beschäftigt und eine unzerstörbare Variante unser äusseren Begrenzung erschaffen möchte lebt eine Pygmalion – Phantasie aus und transplantiert einer jungen Frau, die er gefangen hält neue Hautschichten offenbar in dem Bestreben eine Gestalt nach seinen Wünschen zu erschaffen, was seine medizinischen Forschungsvorhaben zusehends transzendiert und noch etwas dunklere Hintergründe erahnen lässt die über das Pygmalion-Narrativ weit hinausgehen.

Dass dieses Geschöpf zusehends Penelope Cruz ähnelt, die in diesem Film rätselhafterweise nicht mitwirkt, nimmt man schmunzelnd als netten Sidekick zur Kenntnis und hofft dass die beiden inséparables zu dieser Zeit nicht gerade verzofft waren. Aber die platonischen Lieben sind ja bekanntlich die stabilsten …
Der Chirurg – Robert – schnippelt sich also zunehmend die gewünschte Gefährtin zusammen und gerät in einen sich steigernden Zustand von Obsession, während sein Opfer – Vera – offenbar dem Stockholm-Syndrom erliegt, jedenfalls kommt es zu leidenschaftlichen und einvernehmlich anmutenden Liebesszenen. So weit so gut!
Zunächst macht also Almodóvar business as usual – mit leichter Hand und grosser Spielfreude konstruiert und verflicht der Maestro seine Handlungsstränge, mischt die Karten immer wieder neu, zwingt uns Zeitkapseln zu besteigen, ohne uns zu informieren, in welchem Parallelkosmos wir gleich landen werden (zuletzt genossen in Mala educación und Todos sobre mi madre) und wenn wir am Ende glauben, die Zusammenhänge erfasst zu haben … ätsch! Noch ein Joker im Ärmel, der das Spiel noch einmal wendet und neues Sortieren – das beherrscht keiner besser, da kann sogar ein David Lynch einpacken und Christopher Nolan schafft es zwar, das Publikum zu verwirren, aber nicht, es bei der Stange zu halten und pflegt die fehlende Stringenz kontraproduktiv durch zunehmende Action zu ersetzen. Dafür verzeiht man Almodóvar auch seine Camp-Ästhetik, sein Dauerzugpferd Penelope, die Kopfschmerzen, mit denen wir danach wegen neocortikaler Überanstrengung aus dem Kino taumeln und die Fragezeichen in den Augen derer, denen wir den Film hinterher erklären sollen, obwohl wir ihn selbst nicht verstanden haben, aber gerne so täten, als hätten wir; schliesslich hat der Cineast auch einen Ruf zu verlieren. Aber wenigstens wird’s nie langweilig und mit seinen Filmen ist’s ohnehin wie beim Walzertanzen – sobald man anfängt, auf die Schrittfolgen zu achten, klappt’s nicht mehr, Loslassen und Hingabe ist da eher angesagt.
Was fasziniert an diesem Film ausser dem Herumstolpern in einem bunten Irrgarten in der Hoffnung auf Orientierung und dem Begehren nach einer ebenso kathartischen wie verdaubaren Auflösung? Sicher für’s Erste die Konstruktion einer grandiosen (männlichen?) Omnipotenzphantasie: des Erschaffens eines Objektes, das schlechthin alle Bedürfnisse eines traumatisierten Mannes befriedigt. Robert – so erfahren wir – hat seine Frau verloren, sie trug nach einem Unfall schwere Verbrennungen davon und nahm sich nach einem Blick in den Spiegel das Leben – hier hat seine Kunst versagt, ein Schuldthema. Seine Tochter suizidierte sich nach einer Vergewaltigung.
Das Thema des verlorenen Liebesobjektes beschäftigte A. insbesondere nach dem Tod seiner Mutter 1999, demgemäss ist Sprich mit ihr (2002) ein Film über Trauern und Trauerbewältigung beziehungsweise deren wahnhafte Verleugnung, wenn der Pfleger Benigno mit der im Koma liegenden Alicia eine Beziehung unterhält, als wäre diese im Wachzustand und sie schliesslich schwängert und heiraten will. Auch hier das Bild der aggressiven Bemächtigung eines Körpers zur Abwehr von Trauer und Verlust, ein Ersatz für die verlorene Familie, die Wiedergutmachung zur Tilgung einer Schuld, die omnipotente Phantasie, alles wieder selbst erschaffen zu können, was genommen wurde, ein megalomaner perverser Akt und ein gewaltiges Unternehmen bei dem (Spoiler!) noch hinzukommt, dass es sich bei Vera ursprünglich nicht um eine Frau handelt, sondern um den Vergewaltiger seiner Tochter. Die in dessen Körper eingeschriebene Geschichte, wovon die Vergewaltigung ein Teil ist, wird damit ausgelöscht – ein Akt der Vernichtung und der Rache und durch die real erfolgte Kastration auch der zusätzlichen Demütigung des Täters, eine schlussendliche Täter-Opfer-Umkehr mit der tragischen Variante, dass Robert den Körper, durch den seine Tochter Gewalt erfuhr, zusehends leidenschaftlich begehrt – schräger geht’s eigentlich kaum noch.
In der modernen Privatklinik – einer Weiterentwicklung des Frankenstein-Labors – wird also nicht nur Neues geschaffen und libidinös besetzt, sondern auch alte Traumata gelöscht, bis nichts mehr von ihnen übrig ist, glaubt zumindest der Operateur in seinem Zustand des Konkretismus. Eine derart gebündelte Triebbefriedigung in einem einzigen, wenn auch langwierigen Akt zu erreichen, kann als pervertiertes Kunstwerk gesehen werden. Ein anything-goes, das eine gewisse Art Bewunderung erzeugt – allerdings ist die Rolle mit Antonio Banderas, seines Zeichens Latin Lover und Sympathieträger, etwas ungeschickt besetzt, die aalglatte Kälte und Gefühlsentfremdung will bei ihm nicht so recht in den Zuschauerraum sickern – nicht auszudenken, was ein Christoph Waltz oder Willem Dafoe in dieser Rolle ausgelöst hätte, aber dann würde der Film wohl gänzlich ins Horrorgenre kippen und nicht mehr so gut die Spannung halten zwischen Grusel und einer Studie über die Seelennot eines mad scientist und seinem Modus der Problemlösung.
Am Ende kehrt Vera, die sich befreien konnte, zurück an ihren Arbeitsplatz, einen Kleiderladen (Kleid hier definiert als zweite Haut und Indikator der Geschlechtszugehörigkeit), trifft dort ihre Mutter und ihre Kollegin, sie erkennen sie/ ihn nicht mehr – mit dem männlichen Körper hat man sie auch ihrer Vergangenheit, Zukunft und aller ihrer Beziehungen beraubt.
Müssen wir A. nun des male gaze bezichtigen? Der Pygmalion-Mythos ist zunächst einmal ein zutiefst männliches Thema, das ständige voyeuristische Spähen durch reale und virtuelle Fenster und auf Bildschirme ist es auch, trotzdem scheint A. sich immer auf die Seite der Frauen geschlagen zu haben in seiner Kritik an und Persiflierung von Heteronormativität und dem In-Szene-Setzen von aggressiver und toxischer Inbesitznahme von Frauenkörpern durch den Heteromann, ein tragendes Thema in den meisten seiner Filme – aber er zeigt auch Frauen, die Gefallen daran finden (Fessle mich!); eine zweischneidige Botschaft: Einerseits könnte hier der bekannte Beifall von der falschen Seite kommen, andererseits wird der Frau damit auch ein Recht auf individuelle Perversion und ihr lustvolles Ausleben zugestanden.
Ein female gaze? Ich bin nicht sicher beziehungsweise denke eher, man sollte ebensowenig wie bei der Sexualität eingeschränkt polar-langweilig denken und in male and female gazes unterteilen – vielleicht hat der Pedro einfach einen queer gaze. Oder, noch besser: Ein auf den male gaze gerichteter queer gaze, der deswegen aber nicht gleich zum female gaze wird.
So passts … und bei dieser fortgesetzten drögen Frau-Mann-Einteilung hält man sich künftig am besten überhaupt raus.