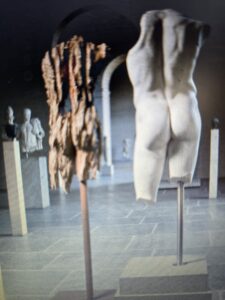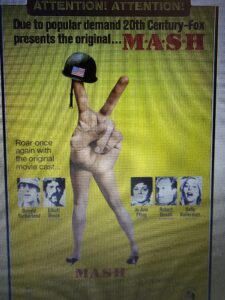Natürlich war der klassische Western ausschliesslich eine Männerwelt und natürlich war sein Bezug zur Realität der Besiedelung des Westens etwas geschwächt. Natürlich war sein Frauenbild in der Regel einfach strukturiert und zwiefach gespalten in herzensgut und verrucht und dieses Geschlecht diente allein der Ornamentik – schmückendes Beiwerk und romantisierendes Element am Rande des Hauptthemas: Männergesellschaften und ihre interpersonellen Spannungen. Frauen waren nicht wirklich mit dem Geschehen verbunden und ohne Funktion im Handlungsverlauf, dafür aber immer zweckmässig gewandet zum Überleben auf staubigen Kampfplätzen, in denen es immer um Leben und Tod ging. Manchmal ähnelten sie mit ihren Reifröcken den Puppen, die früher auf den rückwärtigen Ablagen in Autos sassen und eine Rolle Toilettenpapier tarnten. Charles Bronson hätte Henry Fonda auch ohne die Mitwirkung der Wuchtbrumme Claudia Cardinale zur Strecke gebracht, aber so ergaben sich doch einige prickelnde Momente im ansonsten sehr protrahierten Verlauf des Filmes und die Hoffnungsspannung auf ein glückliches pairing-end blieb bis zum Schluss, was uns aber Sergio Leone dann gottlob doch ersparte – es hätte den Mythos vom Lone Rider und damit den ganzen Film zusammengehauen, der letztlich nur davon lebte. Schmückendes Beiwerk auf Männerspielwiesen.
Der berühmte ikonische Blick von hinten durch die Beine eines der beiden Duellanten auf den Gegner – also aus einer voyeuristischen Beobachterposition auf ein dyadisches Geschehen, nämlich ein Pistolenduell, erinnert an die Blickhöhe eines Kindes, das sich hinter dem Vater versteckt und die Vernichtung des Feindes voyeuristisch aus einer sicheren Position betrachtet. Womit wir bereits auf einer spielerischen Ebene gelandet wären in einer Szenerie, die zunächst alles andere als spielerisch war. Der Exodus der Europäer, bedingt durch Umstrukturierungen in den Heimatländern von agrarischen und feudalherrschaftlichen Strukturen hin zu frühkapitalistischen Produktionsformen erzeugte Unfreiheiten, wirtschaftliche Veränderungen, existenzielle Bedrohungen und eine Verunsicherung der bisherigen Identität, so dass sich viele Hoffnungen auf einen radikalen Ortswechsel in ein grosses Land richteten, das geradezu aufforderte, es in Besitz zu nehmen und seine Ressourcen zu nutzen. Frühkapitalistische Strukturen replizierten sich dann rasch erneut, sobald Grossgrundbesitzer und betuchte „Viehbarone“ ganze Kleinstädte vereinnahmten, indem sie mittels ihrer finanziellen Möglichkeiten Einfluss auf deren bescheidene Kommunalpolitik nahmen, die Gemeindevorsteher, den Friedensrichter und den Marshall schmierten, immer einen Reitertrupp von bodyguards zu ihrem Schutz im Gefolge hatten falls ungeschriebene Gesetze von Newcomern nicht eingehalten wurden und so das alte feudalherrschaftliche Staatsprinzip der alten Welt erfolgreich weiterführten. Der Mensch entkommt sich nicht, egal wie weit er übers Meer schippert.
Die Besiedelung des Westens und das Leben der Farmer, Züchter und Cowboys dürfte bei weitem nicht so aufregend gewesen sein, wie der Western es uns glaubhaft machen will, vielmehr scheint sich hier mit einer Art lautlosem Donnerschlag ein Phantasieraum aufgetan zu haben, in dem die männlich dominierte Filmwelt Hollywoods einen gigantischen Spielplatz für Verfolgungsabenteuer, latente Homoerotik und sonstige Testosteronrituale entdeckte und für sich mit Beschlag belegte, in einer Art sekundärer Kolonisation – ein virtueller Westen, der mit der realen Gegend nicht mehr viel zu tun hatte. Es errichtete die Welt eines permanenten Räuber-und-Gendarm-Spiels in einer riesigen Phantasieblase und eines beständigen Aufeinanderprallens von Outlaws und den Hütern von Recht und Ordnung mit unterschiedlichen Varianten der Sympathielenkung. Der charmante Gauner Billy the Kid hatte die Zuschauergunst eher auf seiner Seite als der furztrockene und illoyale Pat Garrett, dessen Überleben uns eher wurscht gewesen wäre. Der lässige Soundtrack von Bob Dylan brachte dann freilich Tracks für die Ewigkeit.
Ein riesiges und gewissermassen jungfräuliches Land mit reichlich verborgenen Schätzen musste erobert und den ursprünglichen Besitzern sukzessive abgejagt werden, eine stimulierende Phantasie, die die ödipale Enttäuschung des Mannes, den Körper der Mutter nicht vollständig zu besitzen, sondern zeitweise an den Vater abtreten zu müssen, zu kompensieren vermag – nicht selten werden kindliche Konflikte mit den Eltern später auf eine politische Ebene gezerrt und dort rächend oder kompensatorisch ausagiert. Jedenfalls wurden ab dem ersten grossen Western Der grosse Eisenbahnraub (1903), der bereits erste Massstäbe in Aufbau, Schnitt und Kameraführung setzte, der Markt zusehends mit kriegspielenden Jungs geflutet. Dabei stehen die Motive wahlweise der Unbezogenheit im Vordergrund (mehr oder weniger zielloses Lonely-Wulf– Herumstreunen im Gelände mit all seinen wohlweislich nicht dargestellten Mühseligkeiten, das man uns als grandiose Freiheit verkaufte) oder wahlweise die intensive Bezogenheit von Mann zu Mann oder von Männergruppe zu Männergruppe in Form von monate- bis jahrelangem Suchen und Verfolgen des irgendwie definierten Gegners (oder auch gerne aufgrund eines Rachemotivs) im Gelände als Lebensinhalt, voyeuristisches Dauerbeobachten, Spurenlesen und Anschleichen bis schliesslich zum showdown, bei dem man möglichst breitbeinig voreinanderstand, die Intimität eines langen und meist finalen Blickkontaktes genoss und zuletzt blankzog.
Auch der ansonsten erfrischendere und neu angelegte Spaghetti – oder später der Neowestern verzichtete keineswegs auf diese Versatzstücke, auch wenn er sie zeitweise gerne ironisch zitierte. Hier kippt der Abenteuerspielplatz in homoerotisch anmutende tableaus von sich umkreisenden Paaren, die in intensivem Blickaustausch miteinander verschmelzen um jede Regung des anderen schon im Ansatz zu bemerken – der Griff zum Colt zeige sich vorher schon im Auge des Duellanten an – so der Mythos – und ihn dann aufs Kreuz zu legen. Das war nicht nur das Drohstarren, das wir aus der Tierwelt kennen, sondern ein intensives Sicheinfühlen – man muss geradezu in das Auge des anderen hineinkriechen, um den entscheidenden Zeitvorteil zu bekommen. Momente von Intimität und geradezu penetrierender Nähe als Kontrast zu den ständigen Distanzvergrösserungen und -verkleinerungen beim Herumreiten, Flüchten und Verfolgen. Da ist freilich kein Bedarf mehr für Frauen. Und als Charles Bronson seine lebenslange Mission beendet und Henry Fonda erledigt hatte, widmete er sich wieder dem „Jeden-Tag-Leben-mit-dem-Tod „, wie Cheyenne zitierte, den er dann auch noch palliativ wegen eines Lebersteckschusses erschiessen musste. Besonders vernünftig und lebensfreundlich klingt das alles nicht – aber – hach! … wie romantisch und wohltuend traurig …
Stories of love and hate bei den Weissen – welche Rolle wurde nun den Indigenen auf diesen Spielplätzen zugewiesen? Zunächst die der irdischen Aliens samt Auftreten in Horden gleichgeschalteter gesichtsloser Individuen, die die Siedlungen der Weissen überfielen und grausame Blutbäder anrichteten – flott dargestellt in einer nassforschen Umkehr der eigentlichen Landbesitzverhältnisse. Während die Aliens das personifizierte Fremde repräsentierten, eigneten sich die Native Americans mit ihrer Andersgläubigkeit, ihren Ritualen, Gesängen und Tänzen eher zur Verkörperung des Magischen und Irrationalen und mit den langen Haaren, ihrer überwiegend bunten Kleidung samt Schmuckzubehör auch zum Prinzip des Weiblichen, dem man ja ebenso Irrationalität und Bedrohung einer für wohlgeordnet gehaltenen Männerwelt zuschrieb. Nun ist das Weibliche für den Mann nicht nur irrational-gefährlich, sondern auch anziehend und faszinierend, demzufolge konnten sich die Macher des Westerngenres in ihrer männlichen Ambivalenz nie so ganz darüber einigen, wie sie sich zu den Natives stellen sollten – edle Wilde oder grausame Krieger und Marterpfahl-User wechselten sich in buntem Reigen und sorgfältiger Spaltung ab – bis zu den Jahren nach dem 2. Weltkrieg, als der Rassenwahn der Nazis doch so manchen dazu brachte, seine Position zum Andersartigen und Andersabstammenden zu überdenken. Vielleicht auch zum Weiblichen … Der rassistische Charakter des Bildes der Indigenen zeigte sich auch in der Besetzung von Indianerrollen mit weissen Schauspielern, die ihre Charaktere nicht selten parodistisch überzeichneten, heute auch „kulturelle Aneignung“ genannt. Dieses „Redfacing“ hielt sich sehr lange im Genre.
Erst in den 60er-Jahren begann man die Indianer sympathischer zu sehen, wohl auch unter der Weltsicht der Hippies, die sich ihnen verbunden fühlten und gern ihr Outfit kopierten – als kontemplative und naturverbundene Gegenkultur zum zunehmend brutaler werdenden american way of life. Und die Frauen zogen die Korsetts aus (oder behielten sie als humoriges Zitat über den Reithosen an), setzten die Häubchen ab, griffen zum Gewehr und schossen besser als jeder Mann … okay … jede Bewegung kippt erstmal in ihr Gegenteil; das kommt davon, dass man viel Anlauf nehmen muss beim Durchstarten, das war nicht nur beim Feminismus so.
Auf den grossen postkolonialistischen Western, der ohne Idealisierung und Romantisierung die Besiedlung aus der Sicht der Indigenen schildert, nett mit dem Wolf tanzt und auf jegliches John-Ford-und Karl-May-Klischee einmal verzichtet, warten wir noch.
Aber wie wir wissen: Irgendeiner wartet immer.