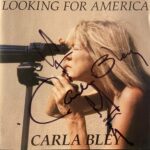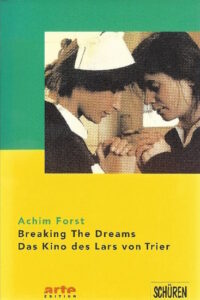Auch wenn ich in letzter Zeit eher sporadisch hier als Schreibender in Erscheinung getreten bin und bei so manchen Entwicklungen und Verwerfungen in diesem Blog außen vor blieb, so hoffe ich doch, dass es vielleicht den einen oder anderen gibt, der sich für meinem Jahresrückblick interessiert. Ich selbst war (bzw. bin noch) über die letzten paar Monate in meinem Hauptberuf als Regisseur in einem Spielfilmprojekt [mit starken dokumentarischen Anteilen, im Opernumfeld verankert] in München involviert, für mich eine überaus wertvolle Phase, da ich in den letzten zehn Jahren ausschließlich dokumentarische Filme im Bereich Musik, Kunst, Theater, Schauspiel gemacht habe und mein letztes Spielfilmprojekt (ebenfalls mit dokumentarischen Anteilen) bereits rund zehn Jahre zurückliegt. Ich wollte hier in diesem Blog gerne etwas mehr Einblick in diese Arbeitsprozesse geben, aber meine Zeit hat das leider nicht erlaubt (zumal ich immer parallel an einigen verschiedenen Projekten arbeite und auch noch als Übersetzer berufstätig bin).
Die Produktion an der Bayerischen Staatsoper, die den Rahmen für unsere Filmproduktion gibt, hatte gestern Abend Premiere (mehr Interessantes dazu hier); wir sind noch eine Weile mit der Filmproduktion beschäftigt – das Ergebnis wird voraussichtlich im Juni in den ARD-Mediatheken veröffentlicht. Ich würde gerne bis dahin in Form von Blogbeiträgen etwas mehr Einblick in die Arbeit bieten.
Mit Film-Jahresbestenlisten halte ich mich aktuell zurück, da ich gemerkt habe, dass meine Maßstäbe für die qualitative Einordnung hier nicht immer auf Gegenliebe stoßen (teils anscheinend sogar als Affront aufgenommen wurden). Wahrscheinlich ist dies ein wenig damit vergleichbar, wie jemand, dem an einer gewissen sprachlichen Qualität gelegen ist (als Autor/in, Literat/in, Texter/in oder auch „nur“ als versierte/r Leser/in), auch bei interessanten Themen nicht darüber hinwegsehen kann, wenn der Text sprachlich schlecht oder auch nur uninspiriert geschrieben ist (an dieser Stelle direkt „sorry“ für meine Texte). Dies gesagt, habe ich in der Tat nur sehr wenige wirklich langweilige Filme in diesem Jahr gesehen, dafür aber viele sehr empfehlenswerte. Der filmkünstlerisch vielleicht herausragendste unter vielen sehr sehenswerten ist wohl Martin Scorseses Killers of the Flower Moon — für jemanden wie mich, der ich mich seit den frühen Tagen meiner Kinoleidenschaft in das Werk Scorseses immer wieder intensiv vertieft habe und dabei sowohl große Meisterschaft als auch manierierte und unfreiwillig komische Filme fand, zählt dieser neue zum Besten, was die Kinokunst zu bieten hat. Und dass Scorsese in einem Alter von 80 Jahren noch einmal ein derart inspiriertes, souveränes Werk hinlegt, das zudem keineswegs altbacken oder altherrenmäßig daherkommt, hätte ich nicht für möglich gehalten.
Einen interessanten Roman möchte ich auch noch empfehlen: The Guest von Emma Cline. (Hier eine Rezension aus der SZ.) Wie ich beim Film immer besonders danach suche, dass wirklich filmisch (d.h. nicht literarisch oder dialoglastig) erzählt wird, so sprechen mich Romane immer dann besonders an, wenn sie auf Weisen erzählen, die ureigen literarische Mittel nutzen, wie sie etwa im Film nicht zum Einsatz kommen können. Dazu zählen oftmals (inspirierte) unzuverlässige Erzähler/innen, auch wenn das auf so subtile und irritierende Weise geschieht wie in The Guest. Ich bin etwas unentschlossen, wie ich den Schluss des Buches finde (reizvoll oder vielmehr unschlüssig?), vielleicht sollte ich das letzte Kapitel noch einmal lesen, aber wie Emma Cline häufig mit dem nicht Naheliegenden und mit dem Nebensächlichen, Flüchtigen, Leerstellenhaften auf Augenhöhe mit ihrer Hauptfigur erzählt, hat mich sehr angesprochen. Passenderweise fand ich in diesem Beitrag/Gespräch zum Buch eben folgendes Zitat dazu: „I was thinking that Emma Cline’s writing reminded me of Cat Power’s cover of Satisfaction, where she removed the parts that at first glance would seem like the important ones.“
Nicht ganz so herausragend, aber reizvoll, auch in der Hinsicht, wie eine Protagonistin (in diesem Fall eine junge Fotografin) als nicht immer glaubwürdige Ich-Erzählerin ihre Biografie darlegt, empfand ich Eliza Clarks Buch Boy Parts … wobei es mich erst recht neugierig auf Clarks zweiten Roman Penance (Guardian review) machte, dessen Prämisse und literarische Form ich enorm vielversprechend finde: „How true can ‚true crime‘ really be, she asks us, with every page of this original, provocative novel.“ (review: Confirms the novelist as one of our most exciting new voices) Heute plane ich, mit dem Roman zu beginnen.
Doch nun zur Musik. Ich muss gestehen, dass ich in den letzten zwölf Monaten, speziell in der zweiten Jahreshälfte, so unglaublich viele tolle Alben hören konnte, dass es mir extrem schwer fällt, mich auf eine „Bestenliste“ festzulegen; vor allem kann ich nur schwer eine Auswahl treffen. Dazu kommt, dass ich einige Alben, die ich sicher hervorragend finde, noch gar nicht gehört habe (die Rolling Stones etwa), und ich gerade vorgestern erst eine Ladung 2023er ECM-Alben gekauft habe, die ich entsprechend noch nicht kennenlernen konnte (Strands, Zartir, Scofield, Danish String Quartet, Pärt und einige mehr). Dafür habe ich diesmal endlich eine gute Handvoll aktueller Intakt-Alben erworben, die ich auch sehr schätze. Ein grandioses Album aus dem Vorjahr, das ich verspätet entdeckte und das nachträglich einen Platz in meinen damaligen Top 3 bekommen müsste, muss ich noch erwähnen: Songs of the Recollection von den Cowboy Junkies — eine Kollektion überaus inspirierter, nicht naheliegender Covers von Songs von David Bowie, Gram Parsons, den Rolling Stones, Neil Young, Bob Dylan, The Cure u.a. Grandios schon die Arrangements.
Meine diesjährige Nummer 1 ist immerhin eine klare Sache, eine australische Band um die Sängerin/Songwriterin Romy Vager (RVG steht für Romy Vager Group), auf die ich nur durch einen beiläufigen Hinweis eines anderen Musikfreundes gestoßen wurde. Ich schaute mir auf seine Empfehlung das – in einer coolen Plansequenz gedrehte! – Musikvideo ihrer Single Midnight Sun an und bestellte mir sofort das Album. Und hörte es in diesem Jahr häufiger als jedes andere. Musikalisch ist das sicher keine große Innovation, aber die Energie und der Witz in Romy Vagers Songs sind einfach famos.
- RVG: Brain Worms
Melbourne’s post-punk quartet RVG boldly expands their sound with synths on their third album, Brain Worms, while staying true to their roots. Filled with catchy melodies, driving rhythms, and Romy Vager’s sharp, insightful lyrics, the album evokes the 80s college post-punk era rather than embracing contemporary genre edges. This new direction, characterized by lush orchestration, haunting melodies, and poetic lyrics, demonstrates the band’s growing maturity, solidifying their status as innovators. Brain Worms rewards repeated listens, unveiling depth and complexity over time, inviting introspection and reflection. It’s a sonic journey that transports the listener to a different post-punk era, showcasing RVG’s influence and innovation today. – The Fire Note Blazing Top 50 Albums of 2023
- Cowboy Junkies: Such Ferocious Beauty – „ranks among the best of the Cowboy Junkies’ work — you can feel the band challenging itself, thriving in the tumult it generates.“ (Scott McLennan)
- Meshell Ndegeocello: The Omnichord Real Book – „The premiere jazz label, Blue Note, is her new home (…) but (…) like Ndegeocello’s best music, it is an exhilarating blend of modern R&B, hip-hop, and the soul/singer-songwriter tradition that includes Stevie Wonder and Bill Withers. (…) the best set of Ndegeocello originals since her early run of albums between 1993 and 2003.“ (Will Layman)
- Depeche Mode: Memento Mori
- Sebastian Rochford / Kit Downes: A Short Diary – „a perfect mood piece that will resonate deeply with a broad array of listeners.“
- Jorja Smith: Flying or Falling – „quite an accomplishment and an excellent vehicle for the singer’s estimable talents. It’s a low-key yet unequivocal triumph.“ (Peter Piatkowski)
- Vril: Animist – „Vril hones in on a dub techno styling that fuses old school Echospace/ Basic Channel minimalism and progressive house to great effect (…) few can match the soul that dwells beneath those sounds (…) fervently bearing the torch of dub techno, whilst also incorporating elements of ambient and experimental house music. (…) an immersive album that blankets the listener with blistering, recurring patterns and tones.“
- Irreversible Entanglements: Protect your Light – „By turns angry, celebratory, mournful, hopeful, here’s an album for complex times.“ (The Guardian)
- Jamila Woods: Water Made Us – „The music takes on many forms, just like the water referred to in the album’s title. The songs are not just liquid, solid, and gas; they are blood, wine, and soul.“ (Steve Horowitz)
- Nils Økland & Sigbjørn Apeland: Glimmer
- Anohni and the Johnsons: My Back was a Bridge for you to Cross
- Sofia Kourtesis: Madres – „The Peruvian producer’s debut album is a shimmery collection of protest chants, club rhythms, and sunlit synths that testifies to dance music’s spiritual nourishment.“ (Steven Arroyo)
- Volker Bertelmann: Im Westen Nichts Neues / All Quiet on the Western Front
- Blur: The Ballad of Darren – „What you can immediately say is that The Ballad of Darren feels like it was from their peak years.“
- Corinne Bailey Rae: Black Rainbows – „An album full of vigorous extremes (her most beautiful, most aggressive and most educational work) that showcases the multi-faceted talents of the reinvented 44-year-old artist.“
- Sylvie Courvoisier with Christian Fennesz, Wadada Leo Smith & Nate Wooley: Chimaera
- Lankum: False Lankum – „Ancient yet trailblazing, it will take you on a Shamanic journey so intense that you will come out the other side feeling like your soul has been washed.“
- Peter Gabriel: i/o
- PJ Harvey: I inside the old year dying
- Lakecia Benjamin: Phoenix – „[L.B.] returns with a provocative, insightful, musically adventurous album centering on feminism and spirituality.“