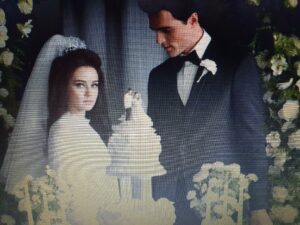Anatomie eines Falles (D, 2023) von Justine Triet
(Seit gestern auf prime streambar – zeitgleich mit dem Oscar-Getöse)
Erster Eindruck:
Noch nie so eine schlechte Synchronisation gesehen beziehungsweise gehört. Da erhebt sich zunächst die Frage, die man sich oft beim Dachbodenaufräumen stellt: Ist das Kunst oder kann das weg? Liegt’s an der Kopie oder ist es künstlerisches Stilmittel, dass die Protagonisten reden, wenn der Mund noch zu ist und umgekehrt? Sind die alle im Nebenberuf Bauchredner?
Am Ende steckt da noch ein tieferer Sinn dahinter, der sich mir nicht erschlossen hat und ein findiger Rezensentenkollege schreibt dann etwa: Durch die raffinierte Zeitverschiebung von Mundbewegung und hörbarem Wort erzeugt der begabte Regisseur eine gezielte Verwirrung die auf die Diskrepanz von innerem Dialog und Gesprochenem zurückweist und damit auf die jedem Menschen immanente Spaltung von schwurbelschwurbelblubb … !
Ich mach mir’s jetzt einfach und denk, es ist die Kopie! Man kann alles übertreiben und zur Kunst deklarieren. Der Film wurde auch dreisprachig gedreht, da mag es wohl babylonisch zugegangen sein.
Hat dieser Film nun den Oscar verdient? Die Frage stellte sich mir am Vorabend der Oscar- Verleihung und ist im übrigen müßig, der Oscar ist alles andere als ein Qualitätssiegel und auch von politischen und ökonomischen Interessen bestimmt und das Gutmenschentum muss auch bedient werden. Im Westen nichts Neues darf man ja auch nicht durchs Raster fallen lassen, ist schliesslich ein Antikriegsfilm und man will ja nicht in den Geruch kommen, Kriege etwa gut zu finden, gerade in den USA, denen wir so manche Kriegsschmonzetten zu verdanken haben, die wohlweislich darauf hinweisen, dass der wackere Amerikaner auch im schlimmsten Kriegsgetümmel menschlich zu bleiben versteht. Natürlich nur für die eigenen Jungs, bei Saving Private Ryan (1998, 5 Oscars!) zu bewundern. Da muss man nicht paranoid sein, um hier nicht eine gezielte Strategie der Filmfachabteilung des Pentagons zu vermuten, in diesem Jahr mussten auch die Republikaner die erste grosse Wahlschlappe einstecken, da muss Mut gemacht werden und das merkt man auch an den Filmen – aber manche sehen noch nicht mal Licht, wenn ihnen aufs Auge gehauen wird. Also immer her mit den goldenen Männchen, Friedensliebe muss belohnt werden. Bei dem restlos verschnarchten Killers of the Flower Moon, den man bequem auf anderthalb Stunden hätte eindampfen können – dann wäre ein Abklatsch von Spannung aufgekommen – dürfte es genauso sein.
Aber zurück in den Gerichtssaal.
Wer einen spannenden Gerichts-Tatort erwartet, ist hier gut bedient (ich hasse Gerichtsfilme, by the way, nach Zeugin der Anklage hab ich da nichts besonderes mehr gesehen und Spannung und Gerichtsplädoyers sind für mich eh inkommensurabel). Wer ein klares Ende erwartet, ist hier wiederum nicht gut bedient, aber das spricht eher für die Qualität dieses Machwerks, weil es das Kopfkino des Zuschauers anwirft und ihn in Spannung hält. Das Geniessen eines „guten Endes“ erinnert eher an die Szene, in der ein Kleinkind den letzten Löffel Brei bekommt, die Mama verkündet, dass jetzt Schluss sei, mit dem Löffel nochmal quer über den Mund fährt, mit dem Lätzchen hinterhertupft und „So!“ sagt! Das macht den Zuschauer zum satten Säugling, wobei ich einräumen muss, dass dieser Zustand auch seine Reize hat.
Und hier gibt es eben kein „So“.
Wir erleben hier – und das ist nichts Neues im Gerichtssaal – die Dekonstruktion einer Frau und einer Familie, die zu Anfang sehr normal anmutet und die Neukonstruktion einer ganz anderen Figur vor unserem inneren Auge mit dem Mittel der Vernehmung und geschickter Plädoyers des Staatsanwalts der in Deutschland einen passablen Mephisto abgeben würde. Das wird fächerartig aufgefaltet und vermag zu faszinieren – ist allerdings nicht neu und viele gute Gerichtskrimis leben davon, etwa bei der ewigen Gretchenfrage, ob nun die Vergewaltigung oder der Kindesmissbrauch denn nun stattgefunden oder nur in der Phantasie der Anklägerin stattgefunden hat oder gar ein Komplott geschmiedet wird gegen einen unliebsamen Vater oder Partner. So neu ist das alles nicht.
Ich musste einmal einem dreitägigen Mordprozess beiwohnen – eine ehemalige Patientin hatte ihre Ehefrau umgebracht – und kenne diesen Wandel innerer Bilder sehr gut. Das strapaziert den Zeugen.
So auch hier: Es zeigt sich das Bild einer zerrütteten Beziehung, eines an der eigenen Unfähigkeit verzweifelnden Mannes, der seine hochgesteckten Ziele nicht erreichen kann und die Verantwortung auf Familie und äussere Umstände abschiebt, mit Schuldzuweisungen aber an der Ehefrau scheitert, die sich klar davon abgrenzt und ihn auf seine Eigenverantwortung hinweist. Die dabei bei ihm erzeugte hilflose Wut führt offenbar zu einer Verstrickung, die im Suizid endet (eine Lesart) und in die er noch den Sohn hineinzuziehen versteht – mit einer mehrdeutigen Botschaft. Diese belastet den Sohn, führt aber schliesslich zum Freispruch der Mutter, wenn … ja wenn … sie überhaupt stattgefunden hat und nicht vom schlauen Sohn erfunden wurde, um die Mutter zu entlasten. Oder ein Ränkespiel von Mutter und Sohn vorliegt.
Die Frage des whodunit tritt zurück beim Betrachten dieses gut eingefädelten Vexierspiels und den Bemühungen des Staatsanwaltes, eine völlig neue Figur zu konstruieren und immer wieder neue Beobachtungen in einer Weise neu zu formen und einzufügen um dieses Bild einer eiskalten Mörderin zu untermauern.
Rechtsprechung hat etwas mit Schriftstellerei gemein – sie konstruiert Figuren und verleiht ihnen eine innere Logik, die mit dem Vorbild nicht unbedingt etwas zu tun haben muss – Details werden entsprechend der Zielvorstellung von Ankläger und Verteidiger passend gemacht – ähnlich wie es mit Erinnerungen geschieht, die nach persönlicher Interessenlage plötzlich eine Modifikation und andere Ausdeutung bekommen. Oder im paranoiden Wahn. Erinnerungen werden plötzlich in einen anderen Kontext gesetzt und bekommen eine andere Bedeutung – wie im Diskurs in den 90ern um frühkindlichen Missbrauch, als viele Frauen ihre Symptomatik in diesem Sinne ausdeuteten und für stimmig befanden, wie man weiss verändern sich Erinnerungen durchaus selbsttätig, jeder zeugenbefragende Polizeibeamte kann ein Lied davon singen. Oft stellten sich dann zugehörige Träume oder „Erinnerungen“ ein – ob sie nun Fakt waren oder nicht. Die „False-Memories“-Bewegung ist verbreitet, vor allem in den USA, dem Land vorpreschender Therapeuten – Hauptsache es ist was los – wurscht was!
Im Verhalten des Kindes wird deutlich, wie sich das Bild der Mutter verändert, Ereignisse eine andere Bewertung erfahren, es will Distanz gewinnen um zu Klarheit zu kommen. Schafft es das oder ist es in einer gemeinsamen mörderischen Inszenierung auf immer mit der Mutter verbunden. Pantha rhei, alles ist im Fluss, alles kann anders gesehen werden, auf nichts ist mehr Verlass.
Schon zu Anfang erschreckt der Film mit tosendem Latino-Soundtrack – später entpuppt sich die Funktion der Musik: Nicht die übliche schlechte Aussteuerung, sondern vielmehr ist die Musik hier ein drittes Element in der Täter-Opfer-Geschichte, es verschleiert die Geschehnisse, akustische Wahrnehmungen die zielführend für die Verurteilung sein könnten werden überdröhnt. Der Genuss bei diesem Film ist nicht die Verbrechensaufklärung, sondern die Momente in denen die Kippfigur kippt. Das kennt man aus vielen guten Krimis und Psychodramen – ob da jetzt haufenweise goldene Männchen dabei rüberwachsen müssen ist jetzt eine ganz andere Frage.
Jetzt wäre mir nach einem eindeutigen guten Ende zumute – läuft irgendwo Vom Winde verweht? Ach nee, die kriegen sich da ja auch nicht … oooder … ahhh … die Fortsetzung: Scarlett – die Serie aus den 90ern. Da kriegen sie sich. Der „So-Effekt“. Nur mal so zur Erholung. Heute Abend droht The Zone of Interest. Da braucht’s geglückte Füttervorgänge zwischendurch!