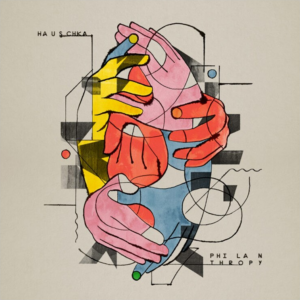Einer flog übers Kuckucksnest! Olle Kamelle?
Eher nicht – gestern mal wieder angeguckt. Es geht noch!!
Nach dem 1962 erschienenen Roman von Ken Kesey funktioniert der 1975 gedrehte Film von Milos Forman immer noch, ohne dass sich das graue Gespenst der Langeweile hereinschlängelt. Schon der Titel – eine Zeile aus einem Nonsens-Abzählreim gibt Rätsel auf, wenn man bedenkt, dass der Kuckuck keine Nester baut. Es wird über etwas geflogen, das gar nicht existiert – macht aber Sinn, wenn man bedenkt, dass diese psychiatrische Station auch den Charakter eines Nestes besitzt, in dem verschiedene Kuckuckseier abgelegt wurden, die ursprünglich nicht dorthin gehörten und aus denen dann überwiegend Zombies geschlüpft sind. Cuckoo ist in den USA auch ein Synonym für „verrückt“.
Zunächst:
Trotz des genialen Jack Nicholson in der Rolle des charismatischen, nicht zu bändigenden und unwiderstehlichen Tunichtguts McMurphy gehört der Film nicht zu meinen Favoriten – zu viele Klischees, zu vorhersehbar, eindimensionale Typen: Der schlitzohrige Rebell, die fiese Oberschwester Ratched, deren Name schon so kratzig klingt, dass da Mildred auch nichts mehr hilft – und mit einer Frisur, mit der sich problemlos zwei Teufelshörner kaschieren liessen. Dann der dauerschweigende Chief, (der Rezensent von Rolling Stone nannte ihn den Häuptling der Herzen), der verklemmte Stotterer und zahlreiche skurril-sympathische Psychofreaks, die sich temporäre Freiheit erkämpfen und in McMurphy ihren Guerillaführer im Klapsmühlendschungel finden. Eher eindimensionale Figuren als gebrochene Charaktere, eher nahe an der Knallcharge, aber als Team unschlagbar und genial aufbereitet vom Regisseur, der später sogar Mozart vom Joch der Idealisierung befreit und genial gegen den Strich gebürstet hat; (davon später ein Weiteres), der hat sich auf seiner Wolke dann sicher tierisch gefreut, vermutlich sitzt er aber eher in der Hölle bei den interessanteren Leuten – wer würde schon mit Mutter Theresa diskutieren, wenn er Sartre haben kann oder gar Nietzsche, der sieht darüber hinaus auch noch gut aus.
Der Film verstand es, den Nerv der Sechziger- und Siebzigergeneration zu treffen – die Rebellion der Unangepassten gegen ein gnadenlos autoritäres System, im Mikrokosmos einer psychiatrischen Klinik in vitro zu beäugen. Dabei trägt er eine etwas verquere Botschaft: Der Unangepasste wird seines Frontallappens beraubt, der angepasst Schweigende erlangt die Freiheit, weil er die Gunst der Stunde zu nutzen weiss, vielleicht vom Instinkt des Indigenen geleitet. Erweist sich das System also als stärker? Eine reaktionäre Botschaft? Ein kurzes Aufleuchten einer kleinen Freiheit vor der brutalen Niederwerfung?
Im Roman ist der schweigende Häuptling der Erzähler, im Film fungiert er als Folie zu McMurphy, zieht die passive Verweigerung der offenen Rebellion vor und versteht abzuwarten; er entkommt dem Kuckucksnest, begleitet von einem Habichtsschrei – vermutlich dem Triumphschrei seines Krafttiers und verschwindet in den Wäldern. Und er entkommt als einziger; der unreflektiert laute Rebell ist tot.
Lasst nicht die roten Hähne flattern ehe der Habicht schreit – sang Degenhardt 1974 in seiner Ballade von Joss Fritz, dem Bundschuhführer, der immer warnte vor der Hast. Dabei dürfte Forman Degenhardt kaum gekannt haben.
Nun muss Literatur nicht immer politisch agitieren – ich war als Studentin etwas zu lange mit einem radikalen Mitglied einer Marx/Lenin-Gruppe verbandelt, da stossen mir gescheiterte Freiheitskämpfe immer noch sauer auf; die proletarische Revolution hat gefälligst zu gelingen, da kann man keine derart pessimistischen Botschaften in die Welt setzen. Aber Belletristik kann auch einfach Realität abbilden, mit Sprache spielen, eine Geschichte erzählen, ein Psychogramm erstellen.
Was ist das hier also für eine Geschichte?
Zunächst ist der Film ein Männerfilm: eine geschlossene Gesellschaft von Herren mit ihrer spezifischen Spiel- und Witzkultur und ihren Initiationsritualen, alle durchaus sympathisch in ihrem Wiedererwachen hin zu einer neuen Lebensfreude und Widerstandskraft; anrührend auch die temporäre Epiphanie und Mannwerdung von Billy Bibbitt, von der Oberschwester aber rasch wieder gekappt und in den Muttersohnstatus zurückgepfiffen, mit tödlichen Folgen, wie wir sehen mussten.

Aber es ist auch ein Männerfilm in der Zeichnung des Frauenbildes, die Frauen – fiese Schwester mit Schleppenträgerin und willige dauerkichernde Prostituierte – dienen eher als fleischgewordene Angst- und Wunschphantasien von Männern und formen sich nicht zu glaubhaften Figuren mit Individualität. Die Oberschwester, der Würgeengel der Psychiatrisierten, kann als Opfer einer verfehlten Personalpolitik gesehen werden – eine Frau eine Station mit schwer gestörten und emotional ausgehungerten Männern regieren zu lassen ist natürlich ein Unding, die kann nur mit Verhärtung und Spiess-Umdrehen überleben.
Ich ertappte mich beim Betrachten als etwas gespalten, mental intellektualisierend und mit eigenen Erfahrungen als Praktikantin in dergestalten Einrichtungen beschäftigt – McMurphy, die Testosteronbombe, hätte mir seinerzeit Angst gemacht; gleichzeitig agierte ich auf der Handlungsebene in der Identifikation mit dem Häuptling: Ich verursachte eine kleine Überschwemmung mit verschüttetem Mineralwasser, es wurde mit einer redundanten Menge an Papiertaschentüchern aufgewischt (der Film endet in einer vom Häuptling verursachten wesentlich grösseren Überschwemmung) und mein Einfall, in Ermangelung eines Putzlappens ein Kissen auf die Wasserlache zu legen, erinnert nun auch sehr stark an die Schlusssequenz.
Das Ende – d. h. die Tötung aus Menschlichkeit am lobotomierten McMurphy durch den Häuptling, der diesen mit einem Kissen erstickt, wurde aus Zeit – oder anderen Gründen von den Mitguckern nicht mehr thematisiert.
Die Frage, was den Regisseur getrieben haben könnte, diesen Roman zu verfilmen, findet vielleicht eine Antwort in Formans Biographie: Seine Eltern waren tschechische Widerstandskämpfer gegen das Nazi-Regime und beendeten ihr Leben im KZ Auschwitz, der damals Elfjährige wurde von Verwandten grossgezogen. Als junger Mann erfuhr er, dass sein Vater nicht sein leiblicher Vater war sondern ein tschechischer Jude, so war er selbst doppelt gefährdet.
Der Stoff einer – wenn auch gescheiterten – Revolution gegen ein mörderisches und totalitäres Regime lag ihm sicher von daher am Herzen, vielleicht hat ihn auch eine frühe Rettungsphantasie für die gefährdeten Eltern angetrieben und Miss Ratched wäre sicher eine hocheffektive KZ – Wärterin geworden.
McMurphy und der Chief – einer die Blaupause des anderen – formen den Film auch zu einem Buddy-Movie. Sie lernen sich auf einer kindlichen Ebene kennen, beim Baseballspielen und Kaugummiteilen, und der Chief teilt mit ihm sein grosses Geheimnis, von da ab wirken sie aufeinander bezogen und zusammengeschmiedet.

Somit handelt der Film auch von Vaterschaft: Der Klinikdirektor ist als Vaterfigur gütig, aber schwach – und durchschaut die Ränkespiele seiner Pflegedienstleitung nicht.
McMurphy versteht es, in einem Haufen geduckter Mitpatienten wieder so etwas wie durchsetzungsfähige Männlichkeit entstehen zu lassen beziehungsweise diese zumindest in den Status eines rebellierenden Jugendlichen zu führen. Der Chief (Veteran aus dem 2. Weltkrieg, den die Demütigung und Landnahme seines Vaters durch Regierungsbeamte depressiv machte) nimmt zum Ende als väterlicher Freund etwas Furchtbares auf sich, um den dahinvegetierenden McMurphy zu erlösen.
Das Mütterliche existiert als Zerrbild, kristallisiert in Schwester Ratched, die niemand aus ihren Klauen lassen kann und das Thema wird verstärkt durch das immer wieder zitierte Phantasma von Billys Mutter, die das genauso wenig erlaubt.
In Werken von Künstlern, die den Vater früh verloren oder ohne diesen aufgewachsen sind, wimmelt es im Oeuvre oft von sich ergänzenden Vaterfiguren unterschiedlichster Couleur. Ich nenne hier Tolkien und die 8 Gefährten, mit denen Frodo Beutlin durch die Lande zog und die unterschiedliche Erziehungs- und Bildungsaufgaben an ihm zu vollbringen hatten, bis ein gestandenes Mannsbild aus dem Kleinen wurde, der dann zwar nicht die Welt, aber zumindest Mittelerde retten konnte. Zu einem Sexualleben reichte es bei ihm allerdings nicht, er verschwand lieber mit Gandalf, Bilbo und Elrond in die nebligen Weiten Valinors, vermutlich zu erneuter romantischer Männerbündelei. Allerdings ist auch die schöne Galadriel mit von der Partie, vielleicht wächst sie ja dann in die Rolle von Schwester Ratched hinein, gottlob hat sie aber ihren Männe Celeborn dabei, der hier hoffentlich Grenzen zu setzen versteht.
Den irdischen Anteil Tolkiens verkörperte der Hobbit Sam Gamdschie, der darauf verzichtete in den Nebel des Unverbindlichen zu entschweben, sondern lieber seine Rosie heiratete, 16 Kinder zeugte und Bürgermeister von Hobbingen wurde. Ob das für Rosie auch genussreich war, ist eine andere Frage.
Tolkien verlor als Vierjähriger den Vater und als Zwölfjähriger die Mutter, war von da ab für den kleinen Bruder verantwortlich, erfüllte also gewissermaßen die Rolle des Seelenhirten und Bodyguards wie sie Sam für Frodo erfüllte.
Ende sidekick!
Was mich beim Kuckucksnest zufriedenstellte, war die Rebellion, die meine 68er-Seele erfreute, das nicht nachlassende Kämpfen für ein besseres Leben, der frische Wind, den ein Revoluzzer in ein faschistisches System hineinzublasen versteht, die Hoffnung die er wecken kann. Das greift immer noch!
Passt aber der Film noch in unsere Zeit, in der wir uns doch viele Freiheiten erkämpft haben? Oder ersticken wir jetzt in Anderem, aus dem uns McMurphy vielleicht befreien könnte mit seinem ungebrochenen Spass am Saufen, sinnlichem Sex, Seefahrt, Sport, Streichespielen (wieso geht das jetzt alles mit S an?) und permanenter lustvoller Grenzüberschreitung – am ganz einfachen aber intensiven sinnlichen Leben und Darüber-Begeistertsein, meinethalben nennen wir’s auch das Feiern des Freudianischen Es.
Hat bei Alexis Sorbas auch gut funktioniert – eine ganze Generation bemerkte erst viel später, dass das ein ziemlich egomaner Vollpfosten war – weil er halt so schön am Strand zu tanzen verstand. Der traf auch dauerquatschend und fingerschnipsend den gleichen Nerv.
Greift der Film deshalb immer noch oder würde vielleicht noch besser greifen als früher wenn ihn nur nochmal jemand zur Erprobung desselben in die Kinos bringen könnte?
Dabei hätten wir doch reichlich Freiheiten zu geniessen, zumindest die privilegierten Schichten unter uns. Sogar Gedankenfreiheit haben wir – jetzt bräuchten wir bloss noch die Gedanken.