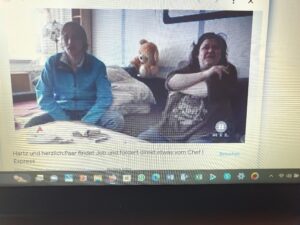The Whale (USA 2022), Darren Aronofsky
Der Plot dürfte bekannt sein: Ein schwerst adipöser Lehrer kann seine Wohnung nicht mehr verlassen, sich kaum mehr bewegen, beschäftigt sich mit Essen, Gay-Pornos und Online-Seminaren über Literatur, bei denen seine Webcam ausgeschaltet bleibt. Er scheint ein guter Lehrer zu sein. In dieser Rolle kann er „ganz Geist“ sein, seinen Körper vergessen und wird von seinen Schülern wertgeschätzt. Ein Quäntchen Lebensinhalt, immerhin … und ein Fall von Fatshaming.
Eine befreundete Krankenschwester versorgt ihn, sie scheinen zusammengeschmiedet wie Gargantua und Pantagruel. Eine dicke Made in ihrem gleichfarbigen Kokon – Khaki – eine Tarnfarbe. So ist man zunächst mit den Show-Werten von Charly beschäftigt – abwechselnd angerührt, angeekelt, insgeheim so mancher auch schadenfroh und fühlt sich zuzeiten auch zurückversetzt in Becketts fatalistisches All that fall mit seinem spezifischen Topos des ewigen Wartens – letztlich ist Godot ja doch der Tod und in diesem Fall lässt der nicht allzu lange auf sich warten.
Er meldet sich sogar gleich zu Anfang, als Charly einen Herzanfall erleidet und nur durch das Vorlesen des Aufsatzes einer Schülerin über Moby Dick wieder zu Atem kommt – auch hier geht es um einen Wal, der getötet werden soll, als Metapher für den gierigen und verschlingenden Anteil seiner selbst. Der weitere Hinweis auf das langweilige Leben der Wale im allgemeinen und das vielleicht ebenso empfundene Leben des Autors von Moby Dick wirft ihn um … bzw er gesundet daran; soviel kindliches Einfühlungsvermögen bewegt ihn und weist zurück auf den Konflikt mit seiner Tochter, die er vor Jahren verlassen hat um eines jungen Lovers willen und um deren Verständnis er in Dauerschleife wirbt. Es beginnt insofern recht vielversprechend. Leider identifiziert sich der Regisseur zunehmend mit seinem Hauptdarsteller, dem nach jedem Anfangsschub gleich wieder die Puste ausgeht und der zur externen Sauerstoffzufuhr greifen muss – und das ist auch das weitere Procedere und Schicksal der Filmhandlung: die Puste reicht nicht. Und leider fehlt dem Regisseur auch die externe Sauerstoffzufuhr. Die restlichen anderthalb Stunden ist man voyeuristisch, fasziniert und abgestossen beim Beobachten von Charlys monströsem Körper und seinen schweisstreibenden Mühen, der allein den Film aber nicht zu tragen versteht, genauso wenig wie die Unterwerfung unter seine kiebige Tochter und ihrer entnervenden Daueraggressivität – eine Figur ohne Tiefenschärfe, ebenso wie die Krankenschwester und der junge Preacherman, dessen Funktion im Handlungsgefüge sich mir nicht wirklich erschlossen hat, ausser dass er sich im Schutzpanzer seiner kruden sektierischen Religion genauso eingeigelt hat wie Charly in seinem Fett, die Tochter in ihrer Aggressivität und die Krankenschwester in einer Form von nicht deutlicher werdendem Frust, auch eine Person die nirgends verortet scheint und keine erkennbare Geschichte hat, also letztlich kein Interesse weckt. Die Figuren bleiben platt.
Man findet sich als Zuschauer eher wieder in einer Position, die vergleichbar ist mit dem Betrachten von RTL2-Realityshows wie etwa Hartz und herzlich, die die sogenannte Unterschicht – jetzt als Prekariat benahmt – neu definiert und in Form eines Menschenzoos vorführt.
Früher war diese Schicht soziologisch beschrieben als arbeitende Klasse, fleissig malochend, standesbewusst und damit revolutionäres Potential, zumindest hätten’s die deutschen Studenten gern so gehabt. Leider wollten die zu Befreienden gar nicht befreit werden. Jetzt besteht die Unterschicht aus einem Cluster von Personen, die eben gerade NICHT arbeiten, von öffentlichen Mitteln leben und ketten-rauchend in einer Dauerregression vor dem Fernseher verfetten.
RTL2 schildert verständnisvoll und teilnehmend deren schwieriges Leben, die Kamera erzählt nebenbei eine ganz andere Geschichte:
Wenn der Sozialhilfeempfänger klagt, dass er keine Reha für seine chronische Bronchitis bekomme oder das Skilager für die Kinder nicht erschwinglich sei, schwenkt sie klammheimlich auf übervolle Aschenbecher, Plasmafernseher, Laptops, Designeroutfits und kunstvoll gestaltete künstliche Fingernägel (eine Art Erkennungszeichen dieser Gruppe), auf dass der Steuerzahler bemerke, wo seine Gelder bleiben. „Parasiten am Volkskörper“ nannte man das früher irgendwann einmal. Ein hundsgemeines Vorführen der ohnehin Abgehängten und einmal mehr eine zynische Ausbeutung, mit der man die Zuschauer erfreut die nun froh sein können, nicht so auszusehen und um diese Loser-Situation im Leben noch einmal herumgekommen zu sein. Und trotzdem den Sozialneid schürt. Auch so ein Schneewittchenspiegel, der uns unsere hässliche Seite zeigt.
Einige Stars dieser Serie haben inzwischen Kultstatus, eigene Blogs und Twitterkanäle und der erste hat bereits seine eigene Sendung im Bezahlfernsehen – aber zurück zu Moby Dick.
Freilich gibt es auch anrührende Momente – insgesamt aber zu dünn gesät, um ein wirkliches Filmerlebnis mit Tiefgang zu gerieren. Da hätte man mehr daraus machen können, wenn man schon Aronofski heisst und bisher viel Brauchbareres abgeliefert hat.
Dem Oscar-Team ging es wohl ebenso: So schnappte der Hauptdarsteller im Fatsuit (Brendan Fraser, früher durchaus ein Sixpack-man) dem Regisseur den ebenso sauer wie wohlverdienten Oskar als bester Schauspieler weg und Aronofsky guckte in die Röhre. Es gibt doch noch so etwas wie Gerechtigkeit.
Das Ende driftet dann vollends ins Theatralisch-Sentimentale: Ein unangebracht melodramatischer Showdown mit halbwegs versöhnter Tochter, bei dem Charly vom Boden abhebt, ins Meer watet und sich dann in Licht auflöst. Schluchz!
Von Aronofsky ist man Besseres gewöhnt, anscheinend hat er mehr auf die Oskars geschielt anstatt einen kritischen Blick auf sein Werk zu richten. So bemerkt der Zuschauer, dass er zwar konsumiert, aber nicht wirklich satt wird und ein paarmal zuviel kompensatorisch in die Popcorntüte gelangt hat.
Und so bleibt der Film Junkfood mit Geschmacksverstärkern, aber ohne wirklich sättigenden Subtext und intellektuellen Nährwert.