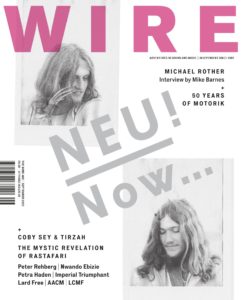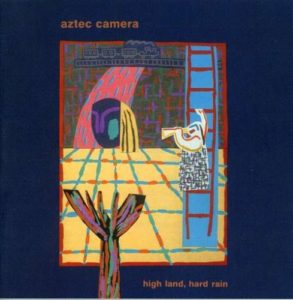La Mala Educación („Die schlechte Erziehung“, Spanien, 2004 ) v. Pedro Almodóvar
Almodóvar beschreibt in diesem Film, in einer intelligenten und faszinierenden Verschachtelung auf drei verschiedenen Zeit- und zweierlei Realitätsebenen, sowie mithilfe des Kunstgriffes des reflexiven Kinos (des Filmes im Film), den seelischen Mikrokosmos eines Opfers und seines Missbrauchers, der am Ende selbst zum Missbrauchten wird. Letzterer ist katholischer Priester, sein Opfer ein etwa 10jähriger Internatsschüler – Ignacio. Obwohl das Erscheinungsjahr schon etwas zurückliegt, ist dies ein Thema von hoher Aktualität. Almodóvar wuchs selbst in katholischen Internaten auf und wurde schon früh mit dergleichen konfrontiert; ob er selbst von Übergriffen betroffen war, ist nicht bekannt.
Das komplexe Geschehen um Bigotterie, Pädophilie, Rache, wechselseitige Identifikation und dem Wunsch nach Aufdecken früherer Verbrechen spielt in einer reinen Männerwelt, in der das Weibliche nur in überformter und pervertierter Weise stattfindet. Padres, Schüler, und Gott, auf den sich alle berufen und der angeblich immer auf der Seite der Priester steht, sind im klaustrophobischen Kosmos eines katholischen Internats miteinander gefangen und sich ausgeliefert – die Kinder den Padres, letztere den pathologischen Strukturen des Systems, in dem sie leben, zudem auch der eigenen Biografie.
Hier geschieht der Missbrauch des Jungen Ignacio durch Pater Manolo, der ihn sich gefügig macht und erpresst mittels der Drohung, seinen geliebten Freund Enrique von der Schule zu verweisen, da er beide zusammen nachts in einer Toilettenkabine glaubte bei „unzüchtigen“ Handlungen ertappt zu haben. Ignacio verkauft sich, um seinen Freund weiter bei sich haben zu können. Er wird aber nicht nur sexuell missbraucht, sondern auch – aufgrund seiner schönen Stimme – zum Sprachrohr verdrängter Sehnsüchte der ausgehungerten Padres; er muss ihnen vorsingen: Lieder voll Herzziehen und schmerzlicher Sehnsucht nach Wiederkehr, Vereinigung und Verschmelzung mit einem Objekt des Sehnens: Moon River, Torna a Sorrento und Cuore Matto – die Blicke der Padres saugen sich an dem Jungen fest, werden verzückt und ekstatisch, wenn sie ihm zuhören, ein Versprechen verspüren, das nie eingelöst werden wird. Ignacio wird zum Sprachrohr dieser Sehnsüchte, die nicht die seinen sind, wird funktionalisiert, er spürt es und leidet unter den Auftritten, für seine eigenen Wünsche bleibt kein Raum, er ist Bediensteter.
Der Film beginnt mit der Wiederbegegnung des nun erwachsenen Ignacio, der sich jetzt Angel nennt und als Schauspieler tätig ist, mit Enrique, der nun als Filmregisseur arbeitet. Ignacio bietet Enrique die aufgeschriebene Geschichte ihrer Internatszeit zur Verfilmung an und möchte selbst die Hauptrolle spielen. Enrique ist an der Geschichte interessiert, hält Ignacio aber nicht geeignet die Hauptrolle zu spielen. In Rückblenden entrollt Almodóvar das vergangene Geschehen in der Internatszeit.

Eingestreut werden Szenen, die der Zuschauer für real hält (Ignacio mit Kleid und Perücke sucht Pater Manolo auf, um ihn mit seinem Wissen und dem geschriebenen Manuskript zu erpressen), später stellt sich heraus, dass es sich um Szenen aus dem entstandenen Film handelt, in dem Ignacio/Angel nun doch die Hauptrolle spielt. Diese gezielte Täuschung des Zuschauers erfährt nun noch eine Wiederholung in einem weiteren Twist, als sich herausstellt, dass Ignacio bereits verstorben und Angel dessen jüngerer Bruder Juan ist, der sich als Ignacio ausgibt.
Noch gehören die Sympathien Juan, der offenbar unter dem Schicksal seines Bruders leidet und ihn rächen möchte, bis wir erfahren, dass Juan der Mörder seines Bruders ist – gemeinsam mit Pater Manolo, der nun Berenguer heisst, mittlerweile den Kirchendienst quittiert hat und durch Enriques Film wieder Kontakt zu Ignacio gesucht und dabei Juan kennengelernt und sich in ihn verliebt hat. Nun kippt die Sympathie des Zuschauers für Angel / Juan. Und wir lernen den „echten“ Ignacio kennen.
Juan ist ein scheinbar eiskalter Mörder, Ignacio ein heroinsüchtiger Transsexueller, zynisch und verbittert, um sich selbst kreisend und nur an Geld für seine Geschlechtsumwandlung interessiert. Gemeinsam mit Manolo besorgt ihm Juan den „Goldenen Schuss“. Ignacio stirbt an der Schreibmaschine beim Schreiben eines Briefes an Enrique, den er wohl immer noch liebt.
Was macht diesen Film so besonders?
Almodóvar erzählt seine Geschichten sonst im linearen Modus, hier bricht er mit dieser Tradition und entwickelt ein Verwirrspiel das den Zuschauer in seinen Bann schlägt. Während er sich in seinen sonstigen Filmen überwiegend mit dem Phänomen Frau beschäftigt zeichnet er hier eine bizarre Männerwelt zu der Frauen der Zutritt verwehrt ist. Einzig die Muttergottes als erstarrte Statue, auf ewig funktionalisiert als Gefäss und Fürsprecherin für die gefallenen Menschen, beobachtet ungerührt die Kinderschändung in der Sakristei.
Die Verdrängung eines Geschlechts in einer wie auch immer gearteten Szenerie führt unweigerlich dazu dass es im Untergrund – zu einer bösen Imago verzerrt – anwesend ist und die Strippen zieht. Die Zeichnung des Weiblichen und dessen Verdrängen aus der katholischen Kirche schafft einen Mythos der unreinen – das heisst Sexualität ausübenden – und unwerten Frau, die unmöglich den Messias in ihrem Leib beherbergen darf, dieser Körper muss unbefleckt sein. Darum loderten damals die Scheiterhaufen. Der Körper der Frau muss vernichtet werden. Der Mann wird kastriert, die Liebe zu einem unschuldigen und „reinen“ Kind und die Vereinigung mit dessen jungfräulichen Körper ist die einzige Möglichkeit für den Priester selbst, in irgendeiner Form unschuldig zu bleiben und doch seine Triebwünsche zu erfüllen – er meidet die erwachsene Sexualität zur erwachsenen Frau.
Der Regisseur hat das weibliche Element in diesem Sinne versteckt in sein Männerdrama eingebaut: neben der Muttergottesstatue erleben wir im „Film im Film“ eine Nonne die eine junge Frau zurückweist, die Novizin werden will wegen ihres vorher vermutlich moralisch nicht einwandfreien Lebens.
Die Mutter von Ignacio und Juan erzählt Enrique, der sie aufsucht, sehr beiläufig und ohne spürbare Erschütterung, dass Ignacio verstorben ist. Sie rekrutierte damals den noch kaum erwachsenen Juan auf den süchtigen und instabilen Ignacio „aufzupassen“, eine drückende und überfordernde Aufgabe für den noch unreifen jungen Mann. Es ist eine zurückweisende und unempathische, eine wenig mütterliche Weiblichkeit, die der Regisseur hier zeichnet, untypisch angesichts seines sonstigen Oeuvres, seiner Bindung an seine eigene Mutter, seiner Wertschätzung für die Frau an sich, wie wir sie sonst von ihm kennen.
Damit vermittelt er das Bild der Frau wie die Kirche sie sieht: Marginal, nur am Rande auftretend, schwer durchschaubar – und sie opfert ihren Sohn Juan um den ausgeklinkten Ignacio versorgt zu wissen, so wie Gott seinen Sohn opferte zum Wohle der Menschheit. Und Kain erschlug Abel um diese Last loszuwerden, nach dem Mord an Ignacio verbrennt Juan dessen ganze Habseligkeiten. Ebenso wie die Padres scheint die Mutter nichts Gutes zu bewirken.
Was ist noch das Besondere an diesem Film?
Almodóvar schafft hier eine in erster Linie eine verwirrende Choreographie im Mikrokosmos von Tätern und Opfern, der Zuschauer wird hineingesogen, verliert zeitweise die Orientierung, muss sich neu zurechtfinden und ringt um Klarheit. Die Motive der Handelnden werden nicht leicht durchschaubar. Das kognitive Erfassen läuft ständig gegen Hindernisse, wie man aus der Hypnotherapie weiss, entsteht dabei eine Art Trance in der die Denkvorgänge blockiert, dafür die Gefühlswelt leichter erreichbar ist. Hier erleben wir das Hineingezogenwerden des Zuschauers in den Strudel der seelischen Zustände der Figuren.
Die Sympathielenkung des Regisseurs geht zu Anfang in Richtung Juan, den wir bei Beginn noch für Ignacio halten; das Opfer, das sein Leiden öffentlich machen will, das verständlicherweise Rachebedürfnisse verspürt. Der Twist, dass es sich nicht um das wahre Opfer sondern dessen jüngeren Bruder handelt sorgt für Verwirrung – was möchte dieser junge Mann? Eine Schauspielerkarriere? Seinen Bruder rächen? Den Priester erpressen? Das könnten wir verstehen, das macht ihn nicht minder sympathisch, zudem kämpft er um die Rolle in Enriques Film und investiert dafür einiges – es geht also auch um seine Existenz. Unser moralisches Empfinden schlägt nicht Alarm.
Das ändert sich bald: Juan entpuppt sich als eiskalter Killer, er verschafft seinem drogensüchtigen und gesundheitlich angeschlagenen Bruder den finalen Heroinschuss. Nun müssen für seine Aktionen neue Erklärungen gefunden werden, Bruderliebe und Rache für den zerstörten Ignacio kann man nun ausschliessen, Juan scheint seine ureigene Zerstörung rächen zu wollen, vielleicht lebenslange Benachteiligung durch die Mutter, wir erfahren es nicht, auch hier bleibt ein Stück Beunruhigung. Ein Vater scheint nicht zu existieren, dafür wimmelt es von perversen Ersatzvätern die einem noch bedrohlicheren Übervater unterworfen sind. Wir erfahren letztlich nicht was Juan wirklich bewegt, aber es entsteht der Eindruck dass er eine Form von Vereinigung mit Ignacio anstrebt, er nimmt nicht nur seine Identität an, er scheint sich geradezu in dessen Leben hineinzubohren wie ein Parasit in den Wirtskörper; ähnlich intrusives Verhalten kennen wir aus Almodóvars „Sprich mit ihr“, in dem der Krankenpfleger Benigno völlig Besitz nicht nur vom Körper der im Koma liegenden Alicia Besitz ergreift, sondern auch ihre Gedanken und Gefühle zu kennen glaubt.
Unberührt vom Schicksal des Bruders ist Juan nicht; nach der Film-im-Film-Szene, als Ignacio das Genick gebrochen wird, bricht er in Tränen aus. Senor Berenguer alias Padre Manolo, der frühere Täter wird nun zu Juans Opfer ; am Ende steht er als der vielleicht einzig Liebende – und damit Schwache und Angreifbare – inmitten eines hasserfüllten Geschehens; auch das muss der Zuschauer verkraften. Und noch einiges mehr: Er erleidet ein zunehmendes Unterminieren seiner Wahrnehmung, wird enttäuscht von dem, dem er seine Sympathie und sein Vertrauen unvorsichtig geschenkt hat. Von den Sprüngen und Volten der Handlung bleibt zunächst Verwirrung. Die Einbrüche zweier verschiedener Zeitebenen verwischen den Realitätsbezug, lassen an der vertrauten Verortung in der Gegenwart zweifeln, die Vergangenheit drängt sich ins Leben und beeinflusst es, die Grenzen verschwimmen – auch der Kunstgriff des Films-im-Film verstärkt die Verwirrung und den Zweifel an den festen Grenzen der Alltagsrealität. Was geht hier vor?
Sympathiegefühle für den schuldigen Padre belasten das Gewissen – wie kann man einen pädophilen Priester plötzlich ganz menschlich finden? Darf er einem leid tun? Versagt hier mein moralischer Kompass? Hier wäre es doch angebracht zu hassen?
Auch das Opfer – der reale Ignacio – erweckt keine warmen und mitleidigen Gefühle beim Zuschauer. Ist das nicht ungerecht? Was ist mit mir los, dass er mir nicht leid tut?

Der Zuschauer verlässt den Film in einem Chaos von Verwirrung, Schuld und Selbstentfremdung, kann das Geschehene nicht zur Gänze durchschauen und Ordnung in der Seele schaffen, in die vertrauten Gut-Böse-Kategorien einordnen und sich so neu orientieren. Opfer- und Täterrollen fallen zusammen, es gibt nicht mehr die vertraute Polarität.
Und damit trifft Almodóvar, ob er es nun so wollte – oder mehr intuitiv den plot gestaltete – exakt das Gefühlsleben von Missbrauchsopfern. Das Beziehungsmuster eines Menschen löst bei der Begegnung mit diesem einen Sog aus, sich in diesen einzuklinken und sich ähnlich zu verhalten und oft auch ähnlich zu empfinden. In der Psychotherapie macht man sich diesen Effekt zunutze indem man das eigene Gefühl und die Resonanz auf den Patienten als diagnostisches Instrument verwenden, um Aufschlüsse über die unbewussten Kräfte und Muster zu bekommen die sein Beziehungsleben prägen und vielleicht sein Scheitern herbei führen. Das geschieht auch in Gruppen als lebendigen Organismen die sich mit einem Patienten befassen, das funktioniert auch bei Film und Literatur.
Was A. im Zuschauer entfesselt, entspricht dem Gefühlsleben von Opfern sexueller Grenzüberschreitungen durch eine nahestehende Vertrauensperson, natürlich in entsprechend abgeschwächter Form. Die Verwirrung über die angeblich positiven Absichten der Täter und deren statusbedingte Unantastbarkeit, das Einordnen in moralische Schemata, welches ständig misslingt, das Zweifeln an der eigenen Wahrnehmung, die zu einem ganz anderen Schluss kommt, die erdrückende Schuld, wenn beim verbotenen Geschehen noch Lust empfunden wird oder man den Täter auch trotz allem noch liebt. Nicht mehr zu wissen wer gut und böse ist. Nicht zu wissen, ob man nicht selbst mitschuldig am Geschehen ist. Keine Orientierng mehr zu haben. Die Gleichzeitigkeit von Vergangenheit und Gegenwart im Inneren und ihr ständiges Sich-Durchdringen, das ein störungsfreies Funktionieren in der Gegenwart verunmöglicht. Erinnerungsfetzen, die in den Alltag eindringen. Nicht glauben zu können was einem angetan wurde von jemandem, den man für integer hielt, der einen vielleicht sogar liebte.
Der Film endet schliesslich im Grau, in Erstarrung und kaltem Regen, der vorher als sprühendes, lebendiges Wasser die Körper der Kinder und der jungen Männer umschmeichelte – jedes Gefühl erscheint nun erstorben. Juan verlässt Manolo / Berenguer, Enrique – der von Anfang an distanzierte Zeitzeuge – wirft Juan – angeekelt wegen seines Betruges – hinaus. Nur Manolo bleibt als Verlassener zurück, letztlich als der einzig Fühlende und vielleicht sogar Liebende. Die Nachricht vom Mord an Padre Manolo durch Juan – er überfährt ihn später mit dem Auto, wie wir im Nachspann erfahren – berührt uns schon kaum mehr, am Ende sind wir selbst abgestumpft von all dem, das auf uns einstürmte. Enrique lebt weiter und dreht Filme – wie Almodóvar selbst, vielleicht ist er ja auch dessen Spiegelbild, ein Alter Ego.
So führt uns A. nach dem Durchschreiten eines Pandämoniums über die Styx in den Hades, den Ort der Schatten, denen man das Leben ausgesaugt hat – und jetzt ahnen wir, wie man sich dort fühlt und vor allem, auf welchen Wegen man dorthin gelangt. Und es ist furchtbar. Und es ist verdammt gut, dass wir es erfahren haben.