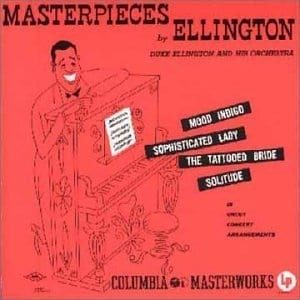Ein älterer Text, auch ein Echo auf „Was die Väter wollten“. Es hat mit der alten Zeit zu tun, dem Beginn der Sechziger Jahre, mit jener Art von Fenstern in eine andere Welt, welche das TV eröffnete, mit Serienträumen und Wildwest – und mit Caterina Valente.
Zu bestimmten Zeiten musste man ins Bett, da gab es kaum Ausnahmen. Auch Fernsehzeiten waren streng begrenzt. 77 Sunset Strip, keine Chance. An dem Abend, von dem ich kurz erzähle, war ich womöglich schon in der Schule, und Tag für Tag notierte ich die Zeit im Aufgabenheft. 1962. 1962. 1962. Die einzige Ewigkeit findet in der Kindheit statt. Ich glaube, es war das Jahr 1962, und einer der ersten Abende, an dem meine Eltern mich allein und das Licht im Flur brennen liessen. Vielleicht war ich aber auch erst fünf und konnte noch keine Jahreszahlen schreiben. Auf jeden Fall wusste ich, wo der Anschaltknopf des Schwarzweissfernsehers war. Ich war noch gar nicht müde und folgte dem Lichtschein im Korridor, betrat das dunkle Wohnzimmer und ging langsam zu der Mattscheibe.
Als das Bild ansprang, war ich voller Abenteuerlust, und mitten in einem Film, in dem es wenig zu lachen gab. Eine Mischung aus einem Gangster- und Gespensterfilm. An was erinnere ich mich? Es gab einen unsichtbaren Mörder, der Menschen mit dem Auto in den Tod beförderte. An die genaue Story kann ich mich natürlich nicht erinnern, aber eine Szene hat sich mir besonders eingeprägt. Ein Mann (das Opfer) steigt in ein Auto ein, aber seltsamerweise auf den Beifahrersitz (vielleicht wurde er auch vorher bewusstlos geschlagen und so ins Auto befördert). Ich habe diese Szene also doch nur bruchstückhaft in Erinnerung, auf jeden Fall sah man dann, wie der Unsichtbare den Motor anliess und losfuhr. Man sah, wie er die Gangschaltung bediente, und ins Eisen stieg. Eine halbe Stunde schaute ich dem Treiben vielleicht zu, länger traute ich mich nicht, weil es ein grosses Theater gegeben hätte, wenn ich von meinen Eltern beim heimlichen Fernsehschauen erwischt worden wäre. Mein Vater beherzigte das Prügeln, mit ihm war zwar oft gut Kirschen essen, aber zuweilen brach etwas Hartes aus ihm heraus.
Ich hatte allerdings noch ein grösseres Problem, denn ich hatte plötzlich Furcht, in der Wohnung im Weissdornweg könne mir der Unsichtbare auflauern und mich töten. Es war auch totenstill in der Wohnung, als ich den Fernseher ausgeschaltet hatte, und das Licht im Flur hatte auf einmal etwas Fahles, als würden von dem matten Lichtschein mehr Dinge verborgen als enthüllt. Eine Heidenangst hatte ich, obwohl ich damals das Wort noch gar nicht kannte, und von geistig tumben Religionslehrern, die einen beim Sprechen ständig ins Gesicht sabberten (fliegende Spucke), obendrein den katholischen Katechismus eingetrichtert bekam wie andere Kinder Lebertran. Das war nicht lustig, ich war leicht von unsichtbaren Welten zu irritieren.
Ganz schlimm waren da – rückblickend – einige Nonnen auf Norderney, Relikte aus Finsterdeutschland, die mir – 1962 – während eines sechswöchigen Aufenthalts – öfter die Hose runterzogen, meinen Po traktierten, und sich daran, trotz gespielter Strenge, sichtlich erfeuten. Aber das konnte ich natürlich nicht durchschauen, damals, als Strafe wurde man noch auf Haferschleim mit Salz gesetzt, und durfte am Wochenende nicht raus ans Meer. Als ich nun in einem Jahr, in welchem ich wahrscheinlich schon Jahreszahlen schreiben konnte, im Bett lag, wurde mir bewusst, dass der Unsichtbare es unter meinem Bett sehr bequem haben könnte, und ich hielt die Luft an, bis mir leicht schwindelig wurde. Dann stocherte ich wie wild mit einer Hand unterm Bett herum, im Schwarzen, stiess aber auf keinen körperähnlichen oder gallertartigen Widerstand.
Die Angst verschwand nicht. Mir war klar, dass hier nicht der Unsichtbare aus dem Film sein Unwesen treiben könnte, wohl aber ein anderer Geist, und ich überlegte, wie ich einen möglichen Eindringling vertreiben könnte. In dem Film war wie hier in Dortmund-Hombruch tiefe Nacht, und alle Opfer waren allein. Aber immer, wenn das Grauen nahte, kündete es sich an durch unheimliche Klänge, schrille Töne, vielleicht waren es die beliebten Horrorsounds einer Theremin. Das Böse schien stets von gnadenlos finsteren Melodien oder aus dem Nichts auftauchenden Schreckenstönen begleitet zu werden, und so schien es mir hilfreich, im Radio nach heiterer Musik zu suchen, nach Schlagern oder Kinderliedern, solchen Kinderliedern, die wirklich lustig waren, und wo niemand tot vom Pferd fiel.
Bangen Herzens schlich ich wieder ins Wohnzimmer und drückte auf die Ein-Taste des Loewe-Opta-Radios. Es dauerte, bis das grüne Auge leuchtete, und es schien mir etwas finster dreinzublicken. Ich drehte am Sendersucher, bis ich ein Lied von Caterina Valente hörte (die Stimme erkannte ich sofort, weil meine Mutter sie gerne hörte und manchmal ein paar Zeilen mitsang). Ich weiss heute nicht mehr, welches Lied es war, aber es war voller Lebensfreude und Überschwang. Ich stellte das Lied ganz laut, und sofort verschwand meine Angst. Mir war auch egal, was passieren würde, wenn meine Eltern heimkämen, weil ich dann ja endgültig gerettet war und schon jetzt sich alle Angst in Luft und Klang aufgelöst hatte. Man durfte nur nicht klein beigeben und musste die Musik richtig laut ertönen lassen, damit die Schallwellen in die hintersten Winkel vordringen konnten.
Ich blieb vor dem Radio hocken, und war ziemlich stolz auf meine Geistervertreibung. Plötzlich hörte ich, wie das Haustürschloss sich drehte (wir wohnten im ersten Stock eines Sechs-Familien-Hauses). Ich kam gar nicht dazu, irgendetwas zu erklären. Die erste Ohrfeige erwischte meine recht Wange mit voller Wucht, aus meinem Vater war wieder etwas ausgebrochen. Der zweite Schlag traf mich in der anderen Gesichtshälfte, und neben dem Schmerz fingen meine Ohren an zu summen. Die Musik wurde sofort ausgestellt, ich lief in mein Zimmer und verschwamd unter meiner Decke. Mir kamen damals erste Zweifel, dass mein Vater in Russland nur auf Hasen geschossen hatte.
Erst die Tränen, dann die Wut, dann die Erschöpfung, irgendwann schlief ich ein, und es war gewiss eine dieser Nächte, in denen ich in einer weiten Prairie in ein gefährliches Abenteuer geriet, und immer, wenn es Spitz auf Knopf stand, rief ich Okko, meinen Traumgefährten: zusammen besiegten wir alle Feinde, und es gab in all den Jahrem, in denen ich diese Serienträume hatte, keinen einzigen, der kein Happy End hatte. Ich weiss nicht, was Okko mit dem Unsichtbaren angestellt hätte, aber er hätte sicher kurzen Prozess gemacht und ihn in die ewigen Jagdgründe befördert. Und mein Radiotrick hätte ihm gut gefallen. Oft spielten sich diese Träume in amerikanischen Landschaften ab, ich las gerne Westerngeschichten, und Robert Fuller aus der Serie „Am Fuss der blauen Berge“ war mein erster Fernseh-Hero. Das war alles vor der Zeit, als ich zum ersten Mal die Kinks und Beatles hörte.

Okko verschwand nach circa zwei Jahren aus meinen Träumen, aber ein Haus weiter wohnte mein Blutsbruder Matthias S. Sein Vater hatte die wunderschönste Spielzeugeisenbahnwelt gebaut, die ich je in meiner Kindheit zu sehen bekam. Mit Matthias zusammen sah ich mein erstes Fussballspiel im Stadion Rote Erde, es ging 2:2 aus, und Uwe Seeler schoss, glaube ich, mindestens ein Tor für die Hamburger. Das hört sich nach behüteter Kindheit an, aber das Grauen schuf sich immer neue winzige Räume; man musste allerdings die Augen weit aufreissen, oder den Blick langsam seitwärts wandern lassen, um sie überhaupt zu erkennen. Ein paar Jahre später las ich alle Kurzgeschichten von Sir Arthur Conan Doyle, in einer Reihe handlicher Heyne-Taschenbücher, und die Titel der einzelnen Geschichten fanden sich in den Rauchwolken von Sherlock Holmes‘ Pfeife.
Und die Antwort von Uschi las sich damals so: Aha, Musik zum Geistervertreiben, da mussma erstmal drauf kommen, eine frühe Prägung? In Ermangelung eines Fernsehers überhaupt oder eines Radios im Schlafzimmer – immerhin bin ich Jahrgang 1948 – stand mir das nicht zur Verfügung, aber ich wähnte – warum auch immer, bei der Religionslehrerin gabs nur Kopfnüsse – den lieben Gott auf meiner Seite, ansonsten bin ich Weltmeisterin im passiven Durchhalten und wähnte auch die Zeit auf meiner Seite bzw deren Vergehen. Bloss wenn man Karsamstagnacht auf den Osterhasen wartete, dann zog sich das schon etwas hin….! Leider brach bei den Vätern immmer viel durch, gottseidank hatte ich in der Kinderzeit keinen, aber was meine Freundinnen da so erlebten, da war kein Vater das beste. Robert Fuller war natürlich eine Schau – aufm Fernseher der Freundin, aber am besten sah schon Bronco Lane aus oder Little Joe, danach High Chapparal uind dann der BEAT CLUB – da hab ich jetzt eine ganze Serie von Folgen erworben, frisch digitalisiert, und wollte auch immer die gleiche Frisur wie Uschi Nerke, mit dem glatten Pony, – ging aber nicht!!!!!!!!!!!!!! ! Locken!!!! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrghhhhhhh!!!!!!!!!!