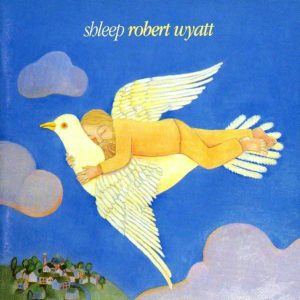… so grün dass es einen förmlich blendete und in den Augen wehtat. Blendung spielte eine grosse Rolle in dieser Zeit, der Nachkriegszeit, die so unbeschwert daherkam. Und so blendend weiss – Waschmittel spielten ja eine tragende Rolle: Die Wäsche musste nicht nur weiss sein sondern superweiss, ultraweiss, nicht nur weiss sondern rein, fasertief rein, porentief rein, weissderteufelwienochrein, schliesslich wurden noch potente Männer und Militaria zum Reinemachen bemüht: Meister Proper und der General. Womit man wieder beim Thema war. Und wenn die Haut darunter litt: Palmolive! Wasch mich aber mach mich nicht nass und mach dass man meinen Händen nicht ansieht was sie getan haben. Am besten wasch sie in Unschuld!
Heute wissen wir sehr gut was da abgewaschen werden sollte, damals noch nicht. In einer alten Persilreklame entsteigt ein mit den Ärmeln fuchtelndes Herrenhemd dem Waschkessel wie ein Geist – ein Relikt aus der Vergangenheit, wird es gleich Haltung annehmen oder den deutschen Gruss entbieten? Wäsche, wasche Dich selbst, ja, so hätte man es gern gehabt. Ödipus blendete sich selbst um seine Schuld nicht mehr zu sehen und vor den strafenden Erynnien, Repräsentanten seines Gewissens, Ruhe zu haben. Obs geholfen hat??
Ebenso ultrarein wie der deutsche Haushalt war die Trivialkunst und der Trivialfilm, schön, sauber und steril, kostümverliebt und happyendsüchtig – Biedermanns Welt. Die Brandstifter im Untergrund ruchbar für den der riechen wollte; die meisten wollten nicht, bis es 20 Jahre später den Studenten dann doch allzu sehr stank und der Protest explodierte. Dann stanks plötzlich aus allen Öffnungen und die Studenten wurden als die Urheber dieser Gerüche angeprangert. Der Überbringer der schlechten Nachricht wird erstmal geköpft.
Die Männerwelt suggerierte im Kino vorwiegend Biederkeit: edle Recken, nette Familienpapas, freche Lausbuben, Clowns und Hanswurste: Gunther Philipp, Rudolf Prack, Heinz Rühmann, Heinz Erhardt, Peter Alexander … lustig, gemütlich, aggressionsfrei, steril und im Bett als Liebhaber nicht vorstellbar. Seht, wie brav wir sind! Nicht mal gepimpert wird. Unmöglich uns das zuzutrauen, was wir noch vor ein paar Jahren angeblich getan haben sollen! Die Verdrängungsmaschinerie war angeworfen – Kriegsschuld und Kriegstraumata wurden verarbeitet durch Verkehrung ins Gegenteil – ein von Anna Freud gut beschriebener Abwehrmechanismus. Man fraß sich satt an Käseigeln und schönen Bildern – unfähig zu trauern.
Im Kino gabs unzerstörte Landschaft statt zerstörter Städte (vorwiegend Tirol, Schwarzwald, Lüneburger Heide – noch nicht Italien, das war ein Schritt weiter), moralisch einwandfreie Frauen, die nicht in Grosstadtschluchten die Kleidung des Feindes trugen und in verräucherten Lokalen in Jeans zu „Negermusik“ tanzten. Exotische Frauen mit schwarzem Haar waren meistens moralisch nicht einwandfrei – die angeblich „slawisch“ aussehende Ellen Schwiers war darauf programmiert den anrüchigen Kontrapunkt darzustellen.

Das Fremde wurde exotisiert anstatt kennengelernt – und damit neu entfremdet, in den Wohnzimmern hingen verführerische Damen, Angehörige eines fahrenden Volkes, das man heute nicht mehr aussprechen darf, glutäugig, tiefdekolletiert und gerne beäugt – funktionalisiert und romantisiert für diffuse Sehnsüchte, nicht als Mitmensch. Hätte sie vor der Tür gestanden hätte man diese zugeknallt. Aber von der Wand nochmals zum Film – der Autor Gerd Bliersbach hat sich der Reflexion dieser Machwerke angenommen, ich versuche mich gerade an einer Fortsetzung über weitere Phänomene.
Es gab z.B. das zwanghaft auftretende Motiv der „Verwechslung“ von Personen, das für Spannung und Heiterkeit in einer Überzahl von Verwechslungskomödien sorgen sollte und perseverierend abgenudelt wurde. Meiner überschlagsmässigen Zählung zufolge bestanden über 60 % der Trivialfilme aus Verwechslungskomödien oder wuchtigeren Falscher-Verdacht-Dramen. Die Zofe tauscht mit der Gräfin das Prachtgewand und trifft sich mit deren Verehrer, der nette Kellner ist in Wirklichkeit der Hotelbesitzer oder umgekehrt, die Erntehelferin ist die Gutsbesitzerin. Und kommt plötzlich in ein schiefes Licht wenn sie auf dem Schoss des alten Grafen sitzend entdeckt wird, der in Wirklichkeit ihr Papa ist – alles bekannt.

Selbst Sissi und Kaiser Franz Josef erkannten sich nicht bei ihrem ersten Treffen im Wald, als Sissi ihm von ihrem „Pappili“ vorschwärmt, ein No – go bei jedwedem Date; die kriegstraumatisierten Eltern mussten geschützt und weiter glorifiziert werden, aber das ist ein anderes Kapitel. Franz Joseph findet das offenbar niedlich und heiratet das Mädel vom Fleck weg. Damit ist Herzog Max in Bayern als Vater der österreichischen Kaiserin auch eine Stufe höher gefallen – auch hier wird wieder ein Vater rehabilitiert und emotional versorgt, by the way. Dem das realiter herzlich wurst war, was im Film aber die aufstiegswütige Herzogin herzlich freut.
Und alles Indikator für die Frage, die alle im Untergrund – wo die Brandstifter hausen – bewegte: Bist Du wirklich der, der Du zu sein vorgibst? Wer warst Du im Krieg – Nazi, Mitläufer, Verweigerer? Und wo stand ich selbst, wer war ich selber? Stehe ich selbst in einem schlechten Licht und was ist mein Anteil daran? Keiner ist der, der er zu sein vorgibt. Sind Soldaten Helden oder müssen sie sich nun fragen ob sie einfach Mörder sind? Waren die Frauen zuhause treue Gefährtinnen oder haben sie sich anderweitig umgesehen? Nagende Zweifel!
In der Verwechslungskomödie gibt es – meistens durch einen Lauschangriff oder ein dramatisches Geständnis – Auflösung, das Paar findet sich, die Buffo – Paare finden sich und jeglicher böse Verdacht löst sich in Luft auf in einer Art Generalrehabilitation. Und einer grandiosen Generalamnestie.
Der Zuschauer als Kind seiner Zeit hat von Anfang an im Kinositz die Rolle des Wissenden, ist – im Gegensatz zum herkömmlichen whodunit – Krimi – eingeweiht und fiebert identifikatorisch dieser Rehabilitation entgegen, in deren Verlauf sich alle Schuld in Wohlgefallen auflöst, oder – seltener – in toto einer Sündenbocksfigur (einem verruchten Kerl oder einer mondän aufgebrezelten Frau) aufgehalst werden kann, die sodann in die Wüste entsandt werden. Wie entlastend! Dieses Motiv wurde filmisch und literarisch (Lore – Romane) in diesen Jahren geradezu suchtartig konsumiert. Unsere Schuld ist gar keine … alles nur ein grosses Missverständnis! Wie schön das miterleben zu dürfen … man bekam nicht genug davon.
Nachkriegsdauerbesoffenheit! Schütt die Sorgen in ein Gläschen Wein! Schau nicht hin, schau nicht her, schau nur gradeaus – letzteres war weiland Marika Rökk.
Ja, ich weiss – dieser Beitrag klingt zynisch und aggressiv – die transgenerational vermittelte Wut steckt noch tief in uns Kindern dieser Zeit, trotzdem verstehe ich auch das verzweifelte Bedürfnis nach Schönheit, Unschuld und Harmonie nach all den furchtbaren Kriegsjahren und dann wird plötzlich Mitleid spürbar für diese geplagte Generation und ihre gestohlenen Lebensjahre, so viele gestohlene Lebenszeit, so viele zerstörte Leben vieler die sich nichts zuschulden kommen liessen. Die in unsere Biographien mit einsickern. Mit dieser Wut nehmen wir eine intellektuell überlegene Position auf dem bequemen Stuhl der späten Geburt ein und spotten über Kitsch. Das ist auch eine Unfähigkeit zu trauern, genau das was wir dieser Generation so gern vorwerfen und was wir selbst ebenso schlecht können. Nur eine andere Form der Abwehr der eigenen Verletzungen auf die wir uns nicht allzuviel einbilden sollten. „Lieber wütend als traurig“ heisst auch ein Buch über Ulrike Meinhof.
Ich guck übrigens grad „Im Prater blühn wieder die Bäume“, die kleine Näherin im geliehenen Fürstinnenkleid soupiert gerade mit dem Erzherzog den sie aber nicht liebt (schnüff!) obwohl er ein ganz Fescher ist und Küssdiehandgnädigesfräulein sagt, der sie aber wiederum schon liebt, aber gar nicht der Erzherzog ist und wieder mal kennt sich keiner mehr aus, der Bräutigam des Mädels stösst dazu und es gibt grosses Getöse – aber das wissen wir jetzt ja alles schon …!
Vielleicht waren diese Szenerien auch für den einen oder anderen die Möglichkeit, aus der posttraumatischen Erstarrung und Eingefrorenheit wieder ins Fliessen zu kommen, da ist es zur Trauer nicht mehr gar so weit, da könnten wir tun, was wir schon lange tun müssten.
Und jetzt ist Mai! Und ich möchte so gern mal wieder nach Wien … ratet mal wohin zuerst? Und ein Kleid tragen mit Rüscherl am Saum und am Ausschnitt … ja, danach wär mir jetzt. Ist das jetzt schlimm?