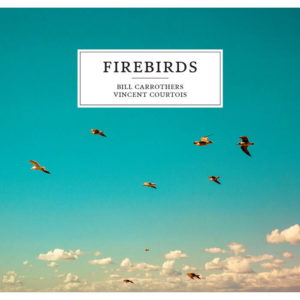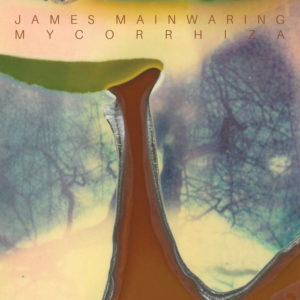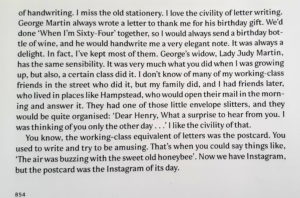JazzFacts – 4.11.21 – 21.05 bis 22.00 Uhr – Deutschlandfunk – von und mit Michael Engelbrecht / Redaktion: Odilo Clausnitzer
Zu Neuem von der improvisierten Musik begrüsst Sie Michael Engelbrecht. In einer Zeit vehementer Klimabedrohungen rücken eine fahrlässig behandelte, rigoros ausgebeutete Natur, eine schon lange nicht mehr unversehrte Heimat, auch in den Fokus von Jazzmusiker*innen. An die Stelle vertrauter Naturromantik tritt eine mitunter dem Unheimlichen Raum gebende Erkundung. Zugleich kann die Natur immer noch als Zufluchtsort dienen.
Einige Werke der kommenden 55 Minuten befassen sich mit unseren Erfahrungen von Heimat, zwischen Geologie und letzter Wildnis, zwischen Schadensmeldung und Rückversicherung. Im Zentrum eine jazzhistorische Ausgrabung ersten Ranges. Und das Finale dieser Stunde gehört dem Bassisten Eberhard Weber, der seit den frühen Siebziger Jahren einige Kapitel deutscher Jazzgeschichte mitgeschrieben hat.
Zu Beginn drei junge Künstlerinnen, drei Ansätze der Improvisation. Wenn eine seit gut zehn Jahren in Oslo lebende Japanerin kundtut, dass sie sich von früh an begeistert habe für norwegischen Jazz und dessen Naturklanginspirationen, erwartet man, noch dazu im allgegenwärtigen Piano-Trio-Format, wohl eher eine lyrische, virtuos-nostalgische Wanderung auf nordischen Klangspuren, und nicht eine dermassen radikale Zuspitzung raumbewusster Gestaltungskunst, Jahrzehnte, nachdem Jan Garbarek auf seinem Meilenstein „Dis“ zu den Sounds einer Windharfe auf seinem Saxofon improvisierte.
Das Album des Trios der Pianistin Ayumi Tanaka, mit dem Bassisten Christian Meaas Svendsen und dem Schlagzeuger Per Oddvar Johannsen, trägt den Titel „Subaqueous Silence“ – „Unterwasserstille“. Seltsam roh und feinnervig zugleich, widerstehen diese asketischen Stücke jedem Anflug lyrischer Schwelgerei. Stattdessen werden kleinste melodische Motive auf eine Art erkundet, dass sie sich in nahezu puren Sound verwandeln. Der Raum zwischen Noten und Geräuschen wird von fast unheimlicher Stille erfüllt. Alles Ruhige ist trügerisch: die extreme Dynamik dieser ECM-Produktion sorgt dafür, dass allem Erkunden entlegener, anscheinend stillster Räume, auch etwas Explosives innewohnt.
M1: Ayumi Tanaka Trio: Ruins II, aus „SUBAQUEOUS SILENCE“

„Ruins II“ aus der CD „Subaqueous Silence“ des Ayumi Tanaka Trios. Während die Japanerin ihre gesammelten Erfahrungen zum Ausgangspunkt einer frappierenden Reduktion des klanglichen Materials macht, geht die Saxofonistin und Komponistin Charlotte Greve genau den umgekehrten Weg. Auf „Sediments We Move“ finden sich Elemente von Ambient, Noise, alter und neuer Chormusik , Free Jazz, Art Rock, und Pop im Gewand der Achtziger Jahre.
Die im Albumtitel vorkommenden Sedimente, uralte Ablagerungen von Gesteinen, über Jahrtausende hinweg entstanden, werden verknüpft mit Stammbäumen von Familien, der Weitergabe der DNA von Generation zu Generation. Ein solch weitreichendes Konzeptalbum wirft die Frage auf, wie die Komponistin die Kontrolle über ihr vielschichtiges Material beibehält, ohne sich in einem allzu opulenten Stilgebräu zu verzetteln. Thomas Loewner folgte den einzelnen Etappen dieses Projekts.
BEITRAG EINS – Thomas Loewner über Charlotte Greve: SEDIMENTS WE MOVE
Thomas Loewner über das neue Werk „Sediments We Move“ von Charlotte Greve. Am 5. Dezember gibt es die Gelegenheit, das Projekt live zu erleben: beim „Releasekonzert“ in der Berliner Kulturbrauerei. /// Linda Frederiksson gehört seit langem zur pulsierenden Jazzszene Finnlands, und ist als Saxofonistin das Spiel in vorzugsweise experimentellen Bands gewohnt. Für ihr erstes Soloalbum „Juniper“ hat sie einen verblüffend melodischen Ansatz gewählt. Sie nennt die Stücke allesamt „Songs“, obwohl kein einziger Songtext auftaucht. Nach eigenem Bekunden hat sie ein Faible für Songalben von Joni Mitchell bis Feist, von Neil Young bis Bill Callahan. Je reduzierter, desto besser. Und sie wollte sehen, was passieren würde, wenn sie diese beiden Welten kombiniert, die freie Ästhetik der improvisierten Musik und die Welt der sparsam instrumentierten Lieder, in der mit kleinen Bausteinen Geschichten erzählt werden.
Ihr Saxofon sollte das Erzählen der Storys übernehmen, Transportmittel für all die tiefgreifenden Erfahrungen in Lockdown-Zeiten sein. Als unmittelbarsten Einfluss nennt sie den leisen, eindringlichen Liederzyklus CARRIE AND LOWELL von Sufjan Stevens – Trauerarbeit und Suche nach verlorener Zeit zugleich. Tonspuren ihrer Demo-Aufnahmen in Scheunen, Hinterhöfen und kleinen Wohnzimmern finden sich auch in der fertigen Produktion, lassen den Stücken ihren fragilen Charakter. Wer nun durchweg sanfte Saxofonklänge erwartet, wird überrascht sein, welche unvorhersehbaren Wege die einzelnen „Songs“ zwischendurch einschlagen – neben Bass und Schlagwerk sind ältere elektronische Instrumente mit wohlklingenden Namen wie „Juno“, „Prophet“ und „Rhodes“ im Spiel – auch „field recordings“ aus der Nähe ihres Sommerhauses.
M2: Linda Frederiksson: „Transit in the softest forest, walking, sad, no more sad“, aus JUNIPER
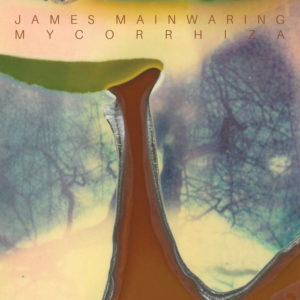
„Transit in the softest forest, walking, sad, no more sad, leaving“ – ein Song aus dem Album Juniper von Linda Frederiksson. Taucht die Natur hier immer wieder als Spiegel persönlicher Erfahrungen auf, befasst sich der englische Komponist, Saxofonist und Multiinstrumentalist James Mainwaring auf dem Album „Mycorrhiza“ mit den vielgestaltigen Überlebenschancen der Wälder. Dass bestimmte Pilze in beschädigten Naturräumen an Repararurmassnahmen beteiligt sind, etwa durch den Austausch von Botenstoffen mit dem Wurzelwerk, ist unstrittig, nicht erst seit Peter Wohllebens Bestseller „Das geheime Leben der Bäume“. Solchen symbiotischen Waldorganismen spürt James Mainwaring nach, in seinem Sextett mit Cello, Bass, Schlagwerk, Elektronik, Gesang, und behutsamem Einsatz von Feldaufnahmen.
James Mainwaring widersteht dabei jener Falle, in die selbst die aussergewöhnlichen Soundtracks von Sir David Attenborough, einem Pionier von Dokumentarfilmen über gefährdete Lebensräume, tappen: statt mit typisch hollywood-artigen Sounds zu arbeiten, gibt er den vom Waldsterben bedrohten Regionen auf „Mycorrhiza“ mit Klangspuren aus Free Jazz und Konkreter Musik ihr Eigenleben zurück. Das Wechselspiel aus schroffen, widerspenstigen und dann wieder lyrischen Passagen, fordert eine aktive Auseinandersetzung heraus, und beschert ein gleichermassen zum Nachdenken anregendes, verstörendes wie abenteuerliches Hörerlebnis. Hier die Komposition „Komorebi“: Das japanische Wort für Sonnenlicht, das durch die Blätter der Bäume gefiltert wird.
M3: James Mainwaring: Year of the Snake, aus MYCCHORIZA
„Year of the Snake“, aus dem Album „Mycorrhiza“ von James Mainwaring. /// Obwohl man glauben könnte, die Archive seien durchforstet und alle wichtigen Aufnahmen der Klassiker des modernen Jazz veröffentlicht, gibt es immer wieder erstaunliche Entdeckungen. Neben bisher unbekannten Einspielungen von Thelonious Monk und Miles Davis tauchten in den letzten Jahren auch bemerkenswerte Aufnahmen von John Coltrane auf – die mit seinem „klassischen Quartett“ entstandene Platte „Both Directions At Once“, und die für einen Film des Regisseurs Gilles Groulx eingespielte Musik mit dem Titel „Blue World“. Nun gibt es mit einer bis dato unbekannten Version von Coltranes „A Love Supreme – Live In Seattle“ eine weitere Überraschung. Bert Noglik berichtet im folgenden Beitrag, warum er dieses Album nicht nur für eine willkommene Ergänzung, sondern aus jazzhistorischer Sicht auch für eine, wenn nicht die wichtigste Neuentdeckung der letzten Jahre hält.
BEITRAG ZWEI – BERT NOGLIK ÜBER JOHN COLTRANES FREE JAZZ VERSION VON „A LOVE SUPREME“
Bert Noglik stellte uns John Coltranes „A Love Supreme Live in Seattle“ vor. Sie hören die JazzFacts im Deutschlandfunk mit Neuem von der improvisierten Musik – und nun die Komposition „Call“ aus dem demnächst erscheinenden Werk „Hymn for Hope“ des norwegischen Bassisten Mats Eilertsen. Der Download ist ab dem 26. November erhältlich, die LP- und CD-Versionen erst im Februar 2022.
M4: Mats Eilertsen: Call, aus HYMN FOR HOPE
Zwölf neue Kompositionen präsentiert Mats Eilertsen auf „Hymn for Hope“. Knapp 80 Minuten lang, ergibt sich im Vinylformat ein klassisches Doppelalbum. Die Produktion entstand im Dezember letzten Jahres in Oslo. Über eine längere Zeit waren von ihm fast nur Werke zu hören, in denen Einkehr und Meditation in weiträumigen Klangbildern den Grundton bestimmten, wie etwa auf seinem Covid 19-Lamento und brillanten Basssoloalbum „Solitude Central“ oder der Manfred Eicher-Produktion „And Then Comes The Night. Hier hingegen, auf „Hymn for Hope“, trotzt er landläufigen Erwartungen an norwegische Improvisationskunst und legt mit jedem Stück eine andere Gangart vor – widerspenstig, ausufernd, frenetisch, in Momenten auch herrlich traumverloren: an seiner Seite Tore Brunborg (dermassen entfesselt hat man den Garbarek-beeinflussten Saxofonveteranen selten zuvor gehört), Thomas Dahl, Gitarre, und Hans Hulbaekmo, Schlagzeug. Szenenwechsel …
M5: Kappeler / Zumthor: Örf, aus: HERD

Auf dem Cover der neuen CD HERD des Schweizer Duos Kappeler / Zumthor ist eine Fotografie – die letzte Prozession des Dorfes Zerfreila, aus dem Jahre 1957, kurz bevor Tal und Dorf nach dem Bau einer Staumauer verlassen und geflutet wurden. Ein Dorf nimmt Abschied von der Heimat. Und damit ist das Thema des Albums umrissen: es geht um die eigenen Wurzeln, um unvergessliche Erinnerungen und Verlustmeldungen, um den Blues, und die Lust am Leben.
An ihrem Instrumentarium erkennt man, dass die Zwei in ihrer Musik beherzigen, was der Philosoph Gaston Bachelard in seinem Buch „Poetik des Raums“ einst so formulierte: „Die Räume der Kindheit müssen ihre Dämmerung behalten.“ Vera Kappeler spielt Piano und Spielzeugpiano, Peter Conradin Zumthor Schlagzeug und Spielzeugpiano. „HERD“ ist reflektierte Heimatmusik, die sich aller nostalgischen „Folklorismen“ enthält. Peter Conradin Zumthor schrieb mir dazu in einer E-Mail:
TEXT Peter Conradin Zumthor (Sprecher) – „Das wichtigste, worauf wir beim Entwickeln schauen, ist, dass es ganz unsere gemeinsame und höchstpersönliche Musik ist, die uns dann Heimat werden kann. Jedes Stück muss einen möglichst klaren und genauen Ausdruck haben. Nur dann vermag es zu berühren. Der Titel HERD kam erst ganz am Schluss dazu. Der Herd, die Küche, die Feuerstelle als Herz des täglichen Lebens. Ein Herd ist somit automatisch immer auch Heimat. Einfach und sehr menschlich. (das Wort „Herd“ hat seinen Ursprung im Wort „Erde“. Ein Wort zum Stück „Orthopedia Avantgarde“. Orthopedia war ein bekannter Rollstuhlhersteller, Avantgarde war der Name eines bestimmten Rollstuhlmodells. Für ein Theaterstück hab ich einen Rollstuhl dahingehend präpariert, dass beim Fahren ein Kabelbinder an den Speichen eines Rades zupfte und so Melodien spielte. die Speichen spielten exakt die Melodie, die nun das melodische Thema des Stücks geworden ist.“
M6: Kappeler / Zumthor: Orthopedia Avantgarde, aus: HERD
Musik aus der CD HERD des Duos Kappeler / Zumthor, eine Veröffentlichung des Züricher Labels Intakt. Und nun, für den Rest dieser Stunde, zu einem noch intimeren Format, der reinen Solodarbietung. Vor zehn Jahren sorgte das erste Piano-Solo-Werk des Pianisten Craig Taborn für grosses Aufsehen.
„Avenging Angel“ reihte sich ein in die Tradition besonderer Solo-Piano-Alben des Labels ECM, und, auch wenn der Jazz lang schon seine postmoderne Phase erreicht hatte, konnte dem Werk aus dem Jahre 2011 eine ähnliche Kühnheit attestiert werden wie den stilprägenden Soloexkursionen von Chick Corea, Paul Bley, und Keith Jarrett.
Wie hat sich sein Solospiel seitdem entwickelt? Craig Taborns „Shadow Plays“ wurde live in Wien aufgenommen am 2. März 2020. Wie entstehen hier aus kleinen Bausteinen Kompositionen, in denen keine Note geplant ist, und doch alles einem organischen Plan zu folgen scheint? Karl Lippegaus hat sich auf Spurensuche begeben.
BEITRAG DREI – KARL LIPPEGAUS ÜBER CRAIG TABORNS CD SHADOW PLAYS
Karl Lippegaus stellte uns Craig Taborns Album „Shadow Plays“ vor. Die heutige Ausgabe der JazzFacts mit Neuem von der improvisierten Musik klingt aus mit einem weiteren Soloalbum, Eberhard Webers „Once Upon A Time – Live in Avignon“. Melodisch, reichhaltig und eigenwillig – Merkmale, die den Sound und die Spielweise seines Elektrokontrabasses so einprägsam machen, seit frühen Klassikern wie „The Colours Of Chloe“, „Yellow Fields“ und „The Following Morning“. Morgen erscheint, fast überrascht es, das einzige Dokument eines Solobass-Konzertes des gebürtigen Schwaben, der im ländlichen Frankreich eine zweite Heimat gefunden hat.
Und was für eine Freude muss es für die Zuhörer gewesen sein, im August 1994, diesen Solo-Exkursionen zu folgen, die so orchestral und intim zugleich anmuten können! Das notengetreue Nachspiel eigener Stücke war nie Webers Sache, und so hält er die Aufmerksamkeit im Hier und Jetzt gefangen, in freizügigen Auslegungen von Stücken seiner vorrangig basssolistischen Unternehmungen „Orchestra“ und „Pendulum“ aber auch, wenn er einmal mit einer gewitzten wie gefühlvollen Version von „My Favourite Things“ eine Spur legt zu Rodgers & Hammerstein, und zu John Coltrane.
Auf dem Cover ein humorvolles Bild in der Tradition Naiver Malerei, von Maja Weber, das an viele ihrer eigensinnigen Cover für ECM und Eberhard Weber erinnert – hier handelt es sich wohl um ein augenzwinkernd-frankophiles Portrait des einstigen Paares als Monsieur und Madame Weber.
Manche Hörerinnen und Hörer werden sich – so sie sich diese wie im Fluge vergehende Zeit dieses Solokonzerts gönnen – erinnern, wieviel erfüllte Zeit, wieviel, neudeutsch, „quality time“, sie ihm verdanken – die Meilensteine aus den Siebziger Jahren halten heute noch ihre Überraschungen und Horizonterweiterungen parat. Die „Colours of Chloe“ verblassen einfach nicht. Bon voyage! Für ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Michael Engelbrecht.
M7: Eberhard Weber: Silent For A While, aus: Once Upon A Time (Live In Avignon) (Ausschnitt, auf Ende spielen, und ein Stückweit dem vorigen Text unterlegen)