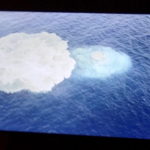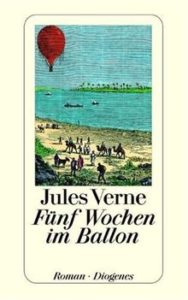Erinnert sich noch jemand an das Zeitalter, als CD-ROMs als die Zukunft der Bildungsvermittlung galten? Als allenthalben von „virtueller Realität“, „digitalen Opern“ und „interaktiven Filmen“ geschwärmt wurde? Die dann allerdings alle miteinander kaum je entstanden, weil niemand so recht wusste, wie man diese neuen Möglichkeiten halbwegs sinnvoll nutzen könnte? Die wenigen Beispiele, die es gab, waren meist wie ein Restaurant, in dem man selber kochen musste (mit freundlichen Grüßen an den damaligen RTL-Chef Helmut Thoma, von dem dieser Vergleich stammt).
Schon wenige Jahre später war die CD-ROM vergessen. Das Internet war einfach schneller, ließ viele Mitwirkende zu, und konnte — anders als die CD-ROM — aktualisiert werden.
Es gab auch Kunst auf CD-ROMs. Laurie Anderson brachte 1995, basierend auf einem Song ihres Albums Bright Red, die CD-ROM Puppet Motel auf den Markt. Eine virtuelle, interaktive Tour durch die Räume eines Motels, entwickelt zusammen mit dem taiwanesischen Künstler Hsin-Chien Huang. Es war kein Erfolg und obendrein ein kurzes Vergnügen: Die Firma, die die CD-ROM auf den Markt gebracht hatte (The Voyager Company), ging sehr bald pleite. Die CD-ROM ließ sich nur auf einem bestimmten Apple-Rechner abspielen, den es schon bald darauf nicht mehr gab. Heute gibt es schon lange keine kompatiblen Geräte mehr.
Nun hat sich wohl doch einmal jemand in ein Computermuseum begeben und sich den Spaß gegönnt, eine Tour durch alle Räume des Puppet Motel aufzuzeichnen. Zur Besichtigung bitte hier entlang. Laurie Anderson ist auch heute noch eine virtuelle Reise wert.