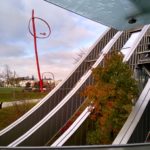Jeder hat sich wohl schon mal die Frage gestellt, wozu man ein Live-Album braucht, wenn man das Studioalbum schon hat. Zwei Live-Alben liegen auf dem Tisch und zeigen, dass sie durchaus ihren Sinn haben können.
John Fogertys neues, lange angekündigtes, Studioalbum lässt weiter auf sich warten. Statt dessen, sozusagen als eine Art Ansichtskarte zwischendurch, gibt es ein Live-Album, mitgeschnitten irgendwann dieses Jahr im Red Rocks Amphitheater in Denver. Nichts wirklich Neues, eher ein „Greatest Hits“, aber in jedem Fall eine gute Ergänzung zum kürzlich veröffentlichten Woodstock-Auftritt der Creedence Clearwater Revival (siehe auch hier). Denn genau darum geht es: John Fogerty feiert sein 50-jähriges Woodstock-Jubiläum mit alten CCR-Nummern und Stücken von seinen Soloalben. Dass er stimmlich nicht mehr die Durchschlagskraft des Woodstock-Auftritts hat — sei’s drum, man erkennt ihn trotzdem noch, und als Gitarrist hat er seit 1969 eine Menge dazugelernt. Mit dabei Johns Söhne Shane (Gitarre, Gesang), der inzwischen selbst ein respektabler Gitarrist geworden ist, und Tyler (Gesang), dessen Zukunft nach meinem Eindruck eher hinter den Kulissen zu liegen scheint, auch wenn ich schon schlechteren Gesang gehört habe. Kenny Aronoff am Schlagzeug trommelt wie gewohnt Volldampf, Bob Malone (keyboards) und James Lomenzo (bass) halten mühelos mit. Das Ganze klingt selbstverständlich anders als zu CCR-Zeiten: Es klingt so, wie John Fogerty die Stücke heute spielt. Auf eine Nummer wie „Rock’n’Roll Girls“ hätte man verzichten können, aber die meisten Fogerty-Kompositionen sind und bleiben unkaputtbar.
Die Überraschung des Albums in der mir vorliegenden Doppel-CD-Version („Walmart-exclusive“; und da Walmart keine ausländischen Kreditkarten akzeptiert, wird diese Version in Europa nur auf Umwegen zu beziehen sein) sind unmittelbare Woodstock-Memories: Coverversionen von „With A Little Help From My Friends“, „My Generation“, „Everyday People“ (das mich heute genauso wie im Original nervt), „Dance To The Music“ und „Give Peace A Chance“, mit Soulgesang (Trysette Loosemore und Lavone LB Seetal) „wie echt“ und ebensolchem Soulgebläse, sind zu hören, und das durchaus hörenswert. Der einzige Missgriff ist Shane Fogertys „Star-Spangled Banner“-Solo — schräge Gitarrensounds mit viel Echo, aber es zeigt letztlich nur, wieviel mehr der Meister draufhatte. Na gut, das Stück hängt am Ende von CD 1 — man hat sich wohl gedacht: Dort stört es am wenigsten.
Um die Verwirrung komplett zu machen, gibt es anscheinend zwei verschiedene 1-CD-Versionen des Albums; eines enthält die Woodstock-Nummern, ein anderes nicht. Im Zweifelsfall darauf achten, welches man bestellt. Es gibt das Konzert auch als DVD und Blue-ray Disc. Vor deren Veröffentlichung wurde das Konzert am 11. November (dem Veteran’s Day) per Satellit in 500 ausgewählte amerikanische Kinos übertragen — allerdings offenbar mit wenig Resonanz. Es gab kaum Werbung, zum Teil gab es technische Probleme, in etlichen Kinos erschien nur eine Handvoll Zuschauer.
Das zweite Album, ebenfalls eine Doppel-CD, ist merkwürdigerweise dichter an Fogerty dran als man vermuten könnte: David Byrnes American Utopia on Broadway.
Die Studioversion dieser Show war letztes Jahr unter meinen Jahres-Top-Ten. Die hier von Byrne und einer elfköpfigen Band präsentierte Live-Fassung aus dem Hudson Theater am New Yorker Broadway ist aber noch um einiges mitreißender, selbst ohne die Choreographie von Annie-B Parson. Das liegt allerdings weniger an den Utopia-Songs, die streckenweise etwas gewöhnungsbedürftig waren, sondern — und das verbindet dieses Album mit Fogertys — an dem mindestens halben Dutzend alter Talking-Heads-Titel, die sich nicht nur fugenlos ins Programm einpassen, sondern den neuen Stücken an Power sogar noch überlegen sind. Es ist verblüffend, wie wenig Tracks wie „Burning Down The House“, „I Zimbra“ oder „Once In A Lifetime“ gealtert zu sein scheinen, obwohl sie um die 40 Jahre auf dem Buckel haben.
Was soll man sagen: American Utopia on Broadway erinnert unweigerlich an Stop Making Sense, der für mich noch immer ein maßstabsetzender Konzertfilm ist. Und die Frage, ob man das Livealbum braucht, wenn man das Studioalbum schon hat, erledigt sich beim Hören von selbst. Ich kenne die DVD noch nicht, bin aber sicher, dass auch sie das Anschauen wert ist.