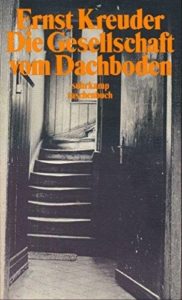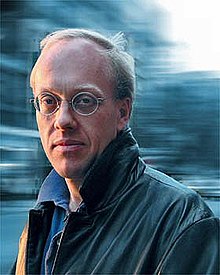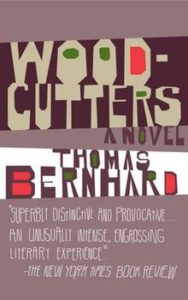Martina Weber: Du hast dich auf eine ganz besondere Art von Interviews spezialisiert, die du auch Nicht-Interviews nennst. Seit November 2014 publizierst du auf dem Poesie- und Literaturportal fixpoetry.com, das von Julietta Fix aus Hamburg gemanagt wird, literarische Selbstgespräche. Auf deiner Webseite erklärst du den Begriff des literarischen Selbstgesprächs so: „Dabei dürfen die Künstlerinnen und Künstler frei drauflos sprechen, während ich ihnen aufmerksam zuhöre, nicht unterbreche und keine einzige Frage stelle.“ Wie bist du auf die Idee gekommen, auf diese Weise Künstlerinnen und Künstler zu Wort kommen zu lassen?
Astrid Nischkauer: Eigentlich waren es zwei Momente, die dazu geführt haben, dass ich die Form des literarischen Selbstgesprächs als Experiment mit offenem Ausgang erfunden und entwickelt habe und auf fixpoetry verwirklichen konnte. Zum einen gab mir die Aussage eines Autors – „Aber ich habe ja gar nichts gesagt“ – nach einer Lesung mit Autorengespräch zu denken. Und dann stellte ich fest, dass man oft viel mehr und interessantere Dinge erfährt, wenn man einfach nur zuhört. Fragen schränken ja immer auch ein, geben einen gewissen Weg oder zumindest eine Richtung vor. Julietta Fix hat dann die Umsetzung meiner Idee auf fixpoetry ermöglicht, wo die Reihe bis heute erscheinen kann, wofür ich ihr sehr dankbar bin. Ohne sie und fixpoetry gäbe es die Reihe nicht.
MW: Auf fixpoetry.com habe ich 39 Interviews bzw. Nicht-Interviews gefunden, die du bisher geführt hast. Darunter Friederike Mayröcker, Marcel Beyer und Clemens J. Setz. Die meisten Interviewten sind Schriftsteller/innen bzw. Lyriker/innen. Welche anderen Kunstsparten finden sich bei deinen Selbstinterviews?
AN: Mit heutigem Stand, Mitte Februar 2019, habe ich 39 Selbstgespräche und ein Interview auf fixpoetry veröffentlicht. Das nächste Selbstgespräch erscheint in Kürze und viele weitere sind in Arbeit, Vorbereitung oder Planung. Friederike Mayröcker habe ich auch zu einem literarischen Selbstgespräch eingeladen, aber sie wollte nicht ganz frei sprechen, hat sich stattdessen lieber Fragen gewünscht. Und Friederike Mayröcker kann man einfach keinen Wunsch abschlagen, deswegen habe ich bei ihr eine Ausnahme gemacht und kein Selbstgespräch, sondern mein erstes und bisher einziges Interview mit ihr geführt.
Und ja, mein Schwerpunkt liegt ganz eindeutig auf Literatur, insbesondere auf Lyrik, die Reihe erscheint ja auch auf fixpoetry. Die Grenzen lassen sich da aber nicht immer so genau ziehen, viele Autoren und Autorinnen sind ja in unterschiedlichen Gattungen tätig, Fiston Mwanza Mujila zum Beispiel schreibt sowohl Lyrik und Romane, als auch Theaterstücke. Aber trotz des Literaturschwerpunkts wollte ich die Reihe von Anfang an offen für andere Kunstsparten halten. Bisher sind auch schon viele Selbstgespräche von Bildenden Künstlern und Künstlerinnen erschienen, darunter Linde Waber, Tomoyuki Ueno oder Ute Langanky. Und mit Klaus Fischedick habe ich auch einen Gärtner dabei, den Gärtner der Museumsinsel und Raketenstation Hombroich.
MW: Wie funktioniert so ein Selbstinterview? Wird das Treffen mit einer gewissen Vorbereitungszeit geplant oder funktioniert es auch spontan? Musst du dich auf ein Selbstinterview vorbereiten? Arbeitest du dich in das Werk des Interviewten ein?
AN: Im Prinzip ist es ganz einfach. Es gibt einige wenige Regeln, die da sind: Das Selbstgespräch wird während eines persönlichen Treffens geführt, also in Form eines tatsächlichen Gesprächs. Wann das Aufnahmegerät eingeschaltet und wieder ausgeschaltet wird, entscheide nicht ich, sondern der jeweilige Künstler oder die jeweilige Künstlerin. Einer der großen Vorteile einer online-Publikation ist, dass uns dadurch theoretisch beliebig viel Platz zur Verfügung steht. Und während das Aufnahmegerät läuft, sage ich dann wirklich nichts, stelle keine Fragen, unterbreche nicht, sondern höre schlicht und einfach aufmerksam zu. Im Anschluss daran transkribiere ich alles Gesagte möglichst genau und ohne einzugreifen, also ohne es zu glätten. Dann schicke ich es den jeweiligen Künstlern und Künstlerinnen nochmals zu und sie dürfen Korrekturen vornehmen, Dinge ergänzen oder auch wieder streichen, wenn sie das möchten.
Die Konzeption der Reihe verlangt einiges an Planung, ich betrachte die Reihe als ein Ganzes und setze immer wieder verschiedene Schwerpunkte, schaue zugleich auf Ausgewogenheit und Abwechslung. Ich bin sehr involviert im Literaturgeschehen, bin selbst Autorin, Übersetzerin, Rezensentin und gehe regelmäßig zu Literaturveranstaltungen. Das alles kann als Vorbereitung für die Selbstgespräche betrachtet werden. Ich überlege mir sehr genau, wen ich einlade. Und ja, ich setze mich mit dem Werk der Autoren und Autorinnen auseinander, viele davon habe ich auch rezensiert, im Vorfeld oder im Anschluss daran. Manche Autoren und Autorinnen begleite ich bereits Jahre lesend und zuhörend. Aus dieser Situation heraus ist es durchaus möglich, dass ich auch ganz spontan Einladungen ausspreche. Ich bin eigenverantwortlich für die Reihe. Julietta Fix hat mir von Anfang an das größte Vertrauen entgegen gebracht und ich bin völlig frei, wen ich einlade. Anders ginge das auch gar nicht.
MW: Würde ein Selbstinterview auch funktionieren, wenn du dich spontan mit einer Künstlerin / einem Künstler treffen würdest, die oder den du gar nicht kennst, eventuell sogar aus einer Kunstbranche, in der du dich nicht auskennst?
AN: Ja. Einige kannte ich vorher noch nicht persönlich, nur ihr Werk. Wie viel Vorlaufzeit es gibt hängt ganz von den Umständen ab und vor allem von den jeweiligen Künstlern und Künstlerinnen. Von den Umständen deswegen, weil mir kein Reisebudget zur Verfügung steht, das heißt, ich führe Selbstgespräche mit anderswo lebenden Künstlern und Künstlerinnen dann, wenn sie beispielsweise eine Lesung in Wien haben, oder wenn ich zufällig auf der Durchreise vorbei komme oder wenn wir uns anderswo begegnen, beispielsweise auf einer Buchmesse. Das Selbstgespräch von und mit Clemens J. Setz haben wir in einem Bahnhofscafé geführt, als ich am Bahnhof in Graz umsteigen musste und ein wenig Zeit war.
Wie viel Vorbereitungszeit die Künstler und Künstlerinnen brauchen ist unterschiedlich. Auf manche Selbstgespräche warte ich Jahre. Es gibt aber auch Selbstgespräche darunter, die ganz spontan geführt wurden, wenn es sich einfach aus einer Situation oder einer Begegnung heraus ergeben hat.
Die Kunstbranche spielt keine Rolle. Es ist ja ganz offen, worüber gesprochen wird, das heißt, es kann über egal was gesprochen werden, es muss überhaupt nichts mit der Arbeit oder dem Werk des Künstlers, oder der Künstlerin zu tun haben. Und es kann auch ohne weiteres über etwas gesprochen werden, womit ich mich kaum auskenne, oder was mich wenig interessiert. Fußball zum Beispiel hatten wir noch nicht, aber es wäre denkbar.
Es muss allerdings in einer Sprache geführt werden, die ich verstehe. Es würde nämlich schon einen Unterschied machen, wenn ich kein einziges Wort verstehen würde und nur so tun müsste, als würde ich aufmerksam zuhören. Und ich transkribiere dann ja auch alles selbst, das geht nur bei Sprachen, die ich verstehe. Beispielsweise ist die Muttersprache von Sarita Jenamani Odia und die von Aftab Husain ist Urdu. Beide haben ihre Selbstgespräche auf Englisch geführt und wir haben sie dann sowohl auf Englisch als auch in deutscher Übersetzung von mir veröffentlicht.
MW: Das Erstaunliche an deinen Selbstgesprächen ist, dass sie oft ganz ausgezeichnet funktionieren. Ich habe den Eindruck, dass die meisten Personen, mit denen du dich zusammensetzt und denen du einfach zuhörst, sehr schnell zum Wesentlichen kommen, zum Kern ihrer Arbeit, ihres Denkens. Und oft habe ich den Eindruck, dass mit der gleichen Person ein sehr gut vorbereitetes konventionelles Frage-Antwort-Interview nicht zu dieser gedanklichen Tiefe kommen würde. Wie erklärst du dir das?
AN: Es gehört viel Mut dazu, sich einem Selbstgespräch zu stellen und ganz ohne Fragen drauflos zu sprechen. Fragen können ein Geländer sein, auf das man sich stützen kann. Zugleich können Fragen mitunter aber schon auch sehr ablenkend sein. Ich biete mit meiner Reihe eine Möglichkeit an, sagen zu können, was man immer schon gefragt werden hätte wollen, was einem ein großes Anliegen ist. Ein gutes Interview zu führen ist eine Kunst für sich, davor habe ich größten Respekt. Es bedarf einer sehr tiefgreifenden Recherchearbeit im Vorfeld und eines guten Einfühlungsvermögens, um die richtigen Fragen zu stellen. Ich möchte meine Reihe nicht als Kritik an der herkömmlichen Form des Interviews verstanden wissen, sondern als eine eigene Form, die auch ganz eigene Möglichkeiten eröffnet.
MW: Die Idee eines Selbstinterviews fand ich zufällig (man kann es auch als Zeichen der Synchronizität sehen) neulich in dem in Hongkong angesiedelten Film „Chinese Box“ aus dem Jahr 1997 (Regie: Wayne Wang). Ein britischer Journalist will eine ihm interessant erscheinende Frau darüber, wie sie die Zeit kurz vor der Rückgabe der britischen Kronkolonie an China erlebt und welche Lebensgeschichte sie hat, interviewen und dabei filmen. In Minute 42 gibt es folgenden Dialog:
Frau: Da wäre noch eins, ich beantworte nicht gerne Fragen.
Journalist: Das ist ein echtes Problem. Ein Interview besteht nun einmal daraus, dass ich Fragen stelle und Sie Fragen beantworten. Das ist das Wesen des Interviews.
Frau: Nicht unbedingt. Die Story wird besser, wenn Sie mir die Kamera geben und ich alles aufnehme. Die ganze Geschichte.
AN: Die Idee ist eine ähnliche und doch grundverschieden. Der Impuls ist nämlich ein anderer. Würde man das Beispiel aus dem Film auf meine Selbstgesprächs-Situation umlegen, würde das so aussehen: Ich habe mir Fragen vorbereitet, treffe einen mir interessant erscheinenden Künstler oder eine Künstlerin, beginne damit ihm / ihr meine Fragen zu stellen und halte ihm / ihr mein Aufnahmegerät hin, das mir der oder diejenige aber aus der Hand nimmt und sagt: „Die Story wird besser, wenn Sie mir das Aufnahmegerät geben und ich die Fragen stelle. Die ganze Geschichte.“ Worauf ich damit hinaus will: Der Impuls zum Selbstgespräch geht nicht von den Sprechenden aus, sondern von mir. Ich ermuntere mein Gegenüber dazu, frei zu Sprechen und das Ruder selbst in die Hand zu nehmen.
MW: Wolf Schneider und Paul-Josef Raue schreiben in ihrem Handbuch des Journalismus, in ihrem Kapitel zum Interview: „Zunächst bedeutet das französische entrevue und das englische interview (davon abgeleitet) nur, daß zwei Personen sich sehen, wahrscheinlich auch miteinander reden wollen. Sprachlich kurios sind demnach das Telefon-Interview (…), und das Interview mit schriftlich gestellten Fragen und geschriebenen Antworten, wie Diktatoren es bevorzugen, weil sie Angst vor peinlichen Fragen oder spontanen Reaktionen haben.“ Schneider und Raue weisen außerdem darauf hin, dass ein gedrucktes Interview immer ein Kunstprodukt ist, das mindestens 30 Prozent von Notizen oder Tonbandaufzeichnungen abweicht. Ich beziehe mich hier auf die Auflage aus dem Jahr 1998. Seit dieser Zeit hat sich die Interviewkultur durch die Möglichkeiten des Internets insbesondere im Literaturbereich insofern sehr verändert, als das schriftlich geführte Interview sehr akzeptiert und geradezu üblich geworden ist. Insofern ist deine Art des literarischen Selbstgespräches eine Technik, die sich zurück bewegt zu den Wurzeln eines Interviews, dem Sich-Sehen.
AN: Die tatsächliche Begegnung, das sich Zeit-nehmen und Zuhören sind der Kern der literarischen Selbstgespräche. Das größte Geschenk, das man einem Menschen machen kann, ist, sich Zeit zu nehmen und zuzuhören.
Es stimmt, dass heute die meisten Interviews schriftlich geführt werden und diese Praktik so selbstverständlich geworden ist für uns, dass sie gar nicht mehr hinterfragt wird. Ein schriftliches Interview hat seine Vorteile, nicht nur für Diktatoren, es geht dabei aber auch sehr viel verloren, gerade auch an Individualität. Es geht ja nicht nur darum, was gesagt wird, sondern auch darum, wie gesprochen wird. Mündlichkeit ist etwas ungemein Faszinierendes.
MW: Es gibt auch Personen, mit denen ein Selbstinterview nicht funktioniert. Die Äußerungen von Peter Waterhouse bei eurem Treffen bestanden aus einigen „mmmh“s, Fragezeichen, Querstrichen, Klammern, aus einigen zusammenhangslosen Wörtern und einem vorbeifahrenden Auto. Barbara Köhler hat einen kleinen Essay zur Reflexion der Methode eines literarischen Selbstgesprächs und dessen Schwierigkeiten und Grenzen geliefert. Welche Voraussetzungen muss eine Künstlerin / ein Künstler für ein literarisches Selbstgespräch mit dir mitbringen?
AN: Wenn man Regeln aufstellt – auch wenn es noch so minimale Regeln wie bei mir sind, die nur einige formale Rahmenbedingungen betreffen, wie dass es in mündlicher Form geführt werden muss – so laden diese Regeln immer dazu ein, unterlaufen zu werden. Ich denke, Peter Waterhouse und Barbara Köhler hatten wohl beide Vorbehalte gegenüber der radikalen Mündlichkeit der Selbstgespräche. Ich transkribiere ja alles ohne es zu glätten.
Bisher habe ich drei Selbstgespräche aufgenommen und transkribiert, welche die Autoren dann schlussendlich doch nicht veröffentlichen wollten. Das ist immer eine Option, die Autoren und Autorinnen dürfen auch ganz am Schluss noch sagen, dass sie es lieber doch nicht veröffentlichen wollen. Das Risiko trage ich allein.
Und es gibt eine Voraussetzung, ohne die es gar nicht geht: Vertrauen. Viele reagieren zögerlich und ausweichend auf meine Einladung, bekunden prinzipiell Interesse, weswegen ich sie dann fix einplane, und erst nach sehr langer Zeit geben sie zu, dass sie sich doch nicht trauen und lieber keines machen möchten. Das macht die Planung zusätzlich schwierig.
MW: Für die Heftpräsentation der Wiener Zeitschrift Triëdere #13 (2/2015) mit dem Schwerpunktthema (Auto)Poetologien hast du eine Collage aus deinen Interviewtexten zusammengestellt. Hier findet sich der Satz „Also auch der Zuhörer beeinflusst ja eigentlich das, was ich spreche.“ Das bedeutet, dass die bei einem Selbstinterview anwesende Person einen enormen Einfluss auf das Gesagte hat.
AN: Der Satz stammt aus dem Selbstgespräch von und mit Wanda Koller, einer jungen Künstlerin, die ich auf der Raketenstation Hombroich kennen lernen durfte. Sie hat das sehr richtig erkannt. Ich sage nichts, aber meine Anwesenheit, mein Zuhören, hat sehr wohl einen großen Einfluss auf das Gesagte. Es kommt da ganz viel hinzu, Alter und Geschlecht spielen eine Rolle, aber auch, wie gut mich mein Gegenüber kennt. Autoren und Autorinnen, die ich im Vorfeld bereits rezensiert hatte, wie Marcel Beyer oder Ilma Rakusa, brachten mir dann beim Selbstgespräch ein sehr großes Vertrauen entgegen, auch wenn wir uns davor persönlich noch nicht gekannt hatten.
MW: Es bedeutet auch, dass jemand in einem Selbstinterview in Anwesenheit einer völlig anderen Persönlichkeit als dir höchstwahrscheinlich über etwas völlig anderes sprechen würde.
AN: Ja. Ort und Zeit spielen auch eine große Rolle. Und selbst wenn ich mit ein und derselben Person ein weiteres, zweites Selbstgespräch aufnehmen würde, wäre es komplett anders. Die Selbstgespräche sind immer auch eine Momentaufnahme und dadurch nicht wiederholbar sondern immer neu.
MW: Die Selbstinterviews sind mit einer Menge Arbeit verbunden. Du tippst die Gespräche, die keine zeitliche Grenze haben und teilweise ziemlich lang sind, ab, du lässt sie vom Sprechenden Korrektur lesen, arbeitest Änderungswünsche ein. Was reizt dich daran? Was für eine Motivation, welches Erkenntnisinteresse steckt dahinter?
AN: Ja, es steckt ein ungeheurer Aufwand dahinter. Vorbereitung und Nachbereitung sind sehr zeitaufwändig. Manchmal kommt auch noch zusätzlich hinzu, dass das Selbstgespräch auf Englisch oder Französisch geführt wird und ich es dann auch noch übersetze. Und das Transkribieren ist ein Knochenjob, vor allem, wenn man das Selbstgespräch irgendwo unterwegs aufnimmt, in einem Café zum Beispiel und die Hintergrundgeräusche zu laut werden, weil sich dann währenddessen jemand an den Nebentisch setzt und ein lautes Gespräch führt, oder wenn auf der Straße plötzlich die Kirchenglocken zu läuten beginnen und nicht mehr aufhören. Und man glaubt es nicht, aber aufmerksames Zuhören ohne etwas sagen zu dürfen ist auch sehr anstrengend. Die längsten Selbstgespräche dauerten rund eine Stunde am Stück, das ist nicht ohne. Ein normales Gespräch ist so aufgebaut, dass sich Sprechen und Zuhören im besten Fall abwechseln, man kann unterbrechen, widersprechen, nachfragen, selbst etwas sagen, oder sprechend Nachdenkpausen einlegen. Aber sobald das Aufnahmegerät läuft, habe ich die Zügel ganz aus der Hand gegeben und bin damit auch bis zu einem gewissen Grad selbst ausgeliefert, weil ich eben nichts mehr sagen darf.
Mich fasziniert an den Selbstgesprächen, dass es jedes Mal aufs Neue ein Experiment mit offenem Ausgang ist. Jeder und jede reagiert anders auf die Situation und die Nicht-Fragestellung. Ich sehe die Reihe als einen Freiraum, den ich geschaffen habe und mit dem jeder und jede umgehen kann, wie sie möchten. Der Motor hinter allem ist meine Neugier, mein Interesse und die große Wertschätzung, die ich meinen Künstlerkollegen und –kolleginnen entgegen bringe. Wie ich Julietta Fix schrieb, als auch der letzte Förderantrag für fixpoetry.com im Jahr 2018 ohne nähere Angabe von Gründen abgeschmettert wurde und sie sehr verzweifelt war: „Wir haben nichts, aber wir können trotzdem etwas geben. Sehr viel sogar.“
Über diesen Link finden sich alle literarischen Selbstgespräche auf Fixpoetry.com, bei denen Astrid Nischkauer keine Fragen stellte.
Die literarischen Selbstgespräche finden sich auch auf der Homepage von Astrid Nischkauer.