on life, music etc beyond mainstream
You are currently browsing the blog archives for the month August 2018.
2018 10 Aug
Hans-Dieter Klinger | Filed under: Blog | RSS 2.0 | TB | Tags: E&U | 7 Comments
Ein besserer Titel ist mir nicht eingefallen, obwohl ich lange nach einem anderen gesucht habe. Erinnert er doch an Frank Sinatras Hit My Way, an einen Song, den ich nicht mag. Der Zufall hat es gegeben, dass ich nicht in Saudi-Arabien, nicht in Syrien, nicht in der DDR, nicht in Bangladesh zur Welt gekommen bin. Ich habe Glück gehabt. Ich bin in einem Wegenetz angekommen, das ich mir freilich nicht aussuchen konnte, das mir aber lieber ist als andere schicksalhaft mögliche.
„I did it my way“ – naja, das tut auf irgendeine Weise jeder. Freilich gibt es eine Auswahl vielgestaltiger Wege: ausgetretene broad ways, verwachsene Pfade, Sackgassen, Seitenwege ‘beyond mainstream’. Der schönsten einer, die sich mir öffneten, ist der Manafonistas Blog. Auf meinen Wegen im schwedischen Lappland umschwirren mich bald Mosquitos, sobald ich stehen bleibe. Und in der Manafonistas Welt finde ich Sätze, die – wenn ich innehalte – sich zuverlässig melden, sich nicht abschütteln lassen, mosquitoartig. Es sind nur wenige, dieser zum Beispiel:
Ganz gewiss gehören weder du noch Gregor zu jenen, die meinen, man sei mit „höheren Weihen“ gesegnet, wenn man in der Klassik weilt (solche Menschen kannte ich aber)
Bei den verzweifelten Versuchen, einen griffigen Namen für die sog. „Klassische Musik“ zu finden, taucht neben anderen der Begriff „Bildungsmusik“ auf. So übel ist er nicht. Das Verhältnis von Claydermans Ballade pour Adeline zu Beethovens Hammerklaviersonate entspricht etwa dem von Mensch ärgere dich nicht zu Schach. In beiden Fällen ist das andere erheblich anspruchsvoller als das eine. „Bildungsmusik“ respektive „Klassik“ war zu meiner Schulzeit einziger Gegenstand der sog. Höheren Bildung im Fach Musik. In den Lehrplänen tauchten Popkultur, Jazz und dergleichen nicht auf. Mein junger Musiklehrer am Gymnasium Münchberg behandelte jedoch den Jazz, entgegen aller curricularer Vorschriften. Sensationell. Seine Wissensbasis war das 1953 erstmals erschienene Jazzbuch J.E. Berendts, welches ich kurz darauf erwarb. So gab es innerhalb meines Klanghorizontes vorerst ausschließlich Klassische Musik – bis zum Alter von etwa 17 Jahren.
Mit „höheren Weihen“ gesegnet fühlte ich mich deswegen nie. Ich komme nicht aus einem Elternhaus, das dem Bildungsbürgertum angehörte. Meine Altvorderen waren vorwiegend Bauern und Handwerker, meine Mama eine Angestellte. Zu Hause wurde nicht musiziert, niemand spielte ein Instrument. Wie es dazu kam, dass mich Musik gepackt und nicht mehr losgelassen hat, weiß ich im Grunde nicht. Wir hatten ein Radiogerät. Meine Lieblingssendung war der Landfunk. Ach was! Es war die einzige Sendung, die ich mir als Vorschulkind anhörte. Die Beiträge zu Ackerbau und Viehzucht habe ich ertragen, der eingestreuten kurzen Volksmusik wegen. Mundgeblasenes gab es einmal im Jahr zum Schützenfest, wenn die Helmbrechts Marching Band zum Festplatz zog und den Tag im Bierzelt verbrachte. Man hätte mich vormittags vor der Kapelle abstellen und nachmittags abholen können. Abends im Bett habe ich dann selbst Musik gemacht, vokale Variationen über Blasmusik, autodidaktische Stimm- und Gehörbildung bis ich in den Schlaf fiel.
Das hat mir meine Mama vor ein paar Wochen geschildert. Sie kann noch viel erzählen, aus ihrer Jugend, von unserer Familie. Als ich 12 Jahre alt war kaufte sie für mich ein Klavier, ein Steingraeber Piano. Es kostete etwa das 10-fache ihres Monatsgehalts.
Als Teenager war ich sogar AFN-Hörer. Wenn ich nach der Schule, nach der Zugfahrt und dem Weg vom Bahnhof zu Hause eintraf, war die Zeit gekommen, da AFN Sinfonische Musik sendete. Niemand hat mich angehalten, gehindert oder gezwungen, Klassische Musik zu hören. Warum ich diesen Weg über manchmal verwachsene Pfade gewählt habe, weiß ich nicht. Die Musik hat mich einfach angetörnt.
Ich war von der Welt abgesondert, niemand in meiner Nähe konnte mich an mir selbst irremachen und quälen, und so musste ich original werden.
Dieser Satz ist nicht von mir, sondern von einem wahren Genie. So etwas kann mir nicht einfallen. Jedoch habe ich, seit ich ihn zum ersten Mal gelesen habe, das Gefühl, dass er nicht ganz unpassend meine musikalischen Wege charakterisiert.
2018 9 Aug
Manafonistas | Filed under: Blog | RSS 2.0 | TB | Comments off
2018 8 Aug
Manafonistas | Filed under: Blog | RSS 2.0 | TB | Comments off
THIS GRIPPING account of a singular rock’n’roll life – David Crosby’s half-century odyssey in classic records, lunatic success, near-fatal excess and stubborn resurrection – begins with an early memory: the singer recalling a transportive night at a club watching John Coltrane in unhinged-solo flight. Crosby’s frenzied imitation of the jazz titan wailing free is hilarious. But the lesson was enduring. “I never heard anybody be more intense with music than that,” Crosby says in awe. What follows in David Crosby: Remember My Name – directed by A.J. Eaton and produced by Oscar-winning rock writer Cameron Crowe – is the story of how Crosby repeatedly sought that passion and light as a singer and songwriter, at steep cost.
In a mix of richly anecdotal candid new interviews and rare archival footage, rock’s ultimate lion-in-winter – with that long, white mane and signature moustache punctuating his broad, weathered features – relives his extended seesaw of triumph and error: immediate fame with The Byrds, then in rock’s first supergroup with Stephen Stills, Graham Nash and (sometimes) Neil Young; the libertine streak and outspoken ego that tested romances and friendships; the drug addiction that put him in prison; the heart attacks and liver transplant that have left him in perilous health. Now 77, Crosby is in a solo-album renaissance. (Disclosure: My writing on that work is referenced in the opening frames.) But estranged from his old bandmates, with record sales falling, Crosby keeps touring to pay the bills since, as he drolly points out, he is the only member of CSNY “without a hit”. Crosby’s wife Jan soberly notes in turn that whenever her husband leaves home, with his battery of medicines, she knows he may not return.
Remember My Name is set on parallel road trips: one with the singer’s current, excellent Lighthouse band; the other a swing through ’60s and ’70s turning points in his hometown, Los Angeles. Cruising what’s left of the Sunset Strip’s old magic, Crosby – who was chubby and insecure as a child – is exuberant about his short ride with The Byrds and frank about the big mouth that got him fired. When he visits the Laurel Canyon home immortalised in Nash’s Deja Vú ballad Our House, Crosby points to the porch where he says the idea for CSN was hatched. That is followed by a 1969 reel of them arguing violently on that porch, on the eve of their first concert.
Eaton and Crowe named their film after Crosby’s despairing 1971 masterpiece, If I Could Only Remember My Name, made in the wake of a profound loss: the 1969 death of his girlfriend Christine Hinton in a car accident. Here, the title’s shift in tone, to emphatic request, catches a confessional and redemptive urgency running through the striving, glory and breakdown. Early in the movie, Crowe, off camera, offers Crosby a hypothetical trade: no music – with none of the rewards and sorrows he’s known – in exchange for an idyllic home and family life. “Me? No music? That’s no world for me,” Crosby replies. “It’s the only thing I got to offer.”
David Fricke, MOJO (posted here for two days)
2018 7 Aug
Lajla Nizinski | Filed under: Blog | RSS 2.0 | TB | Comments off
Die Piazza Grande von Locarno ist magisch. Von allen Seiten ist sie betretbar, nach allen Seiten bietet sie Flucht, wenn ein gewaltiges Unwetter über sie fegt. So geschehen am letzten Freitag, als Meg Ryan den Leoparden entgegennehmen und direkt anschließend der deutsche Film WAS UNS NICHT UMBRINGT von Sandra Nettelbeck gezeigt werden sollte. Ganz mutige Kenner der lokalen Naturgewalten und sonstige angereisten Wetterresistenten blieben trotz elektrisch aufgeladener Strahlen auf ihren gelben Plastikschalen sitzen.
Ich flüchtete ins Feve, ein erstaunlich großes Auditorium für das doch kleine Locarno. Als ich total durchnässt ankam, stand schon Sandra Nettelbeck mit ihrem gesamten Team auf der Bühne und be/warb sympathisch um den Publikumspreis für ihren Film.
Der Inhalt ist schnell erzählt: Ein Psychotherapeut mit eigenen Grenzen versucht einem aus Kummer stummen Koch, einem an Flugangst leidenden Piloten, einer Spielsüchtigen, einem Bestattungsunternehmer mit ängstlicher Schwester und seiner Ex zu helfen. Aus den einzelnen Episoden hätte Sandra Nettelbeck eine Serie à la „In Treatment“ basteln können. Sie überfordert sich und den Zuschauer mit Überladungen. Alle sollen auf der Suche nach Liebe nicht an sich selbst scheitern.
Schmunzelnd sei an ihren Vater Uwe Nettelbeck erinnert, der in seinen Bänden „Mainz wie es singt und lacht“ die krudesten Geschichten sammelte. Den ausgezeichneten Musikgeschmack hat sie wohl auch von ihm, für die Filmmusik hat sie Hauschka ausgesucht. Super. Alle ihre Schauspieler waren exzellent für ihre Rollen ausgewählt. Johanna ter Steege spielt einfach umwerfend die Spielsüchtige.
Was für ein Unterschied zu Meg Ryan, die ich anschließend in dem Film IN THE CUT (2003) gar nicht hervorragend fand. Ihre schauspielerische Leistung ist mäßig. Wir kennen die Regisseurin Jane Campion von dem Film „Das Piano“. Campion’s Themen sind Macht und Sex in der Perversion. Nicht von ungefähr hat ihr Film In The Cut Aufnahme in THE PERVERT S GUIDE (2006) gefunden. Kein geringerer als Slavoj Zizek analysiert ihn darin anerkennend. Vielleicht sollte ich noch ein Ohrenmerk auf die Musik in ihrem Film legen. Der isländische Musiker Hilmar Örn Hilmarsson unterstreicht die bitteren Szenen und führt uns in die dunkelsten Schattenseiten des Lebens.
Einen Film hätte ich zu gerne gesehen, leider blieb keine Zeit. Ob es ein Trost ist zu wissen, dass derselbe Regisseur verantwortlich ist für die Soapoperas „Before Sunset“ oder after und dann wieder before …? Ja Ethan Hawke zeigt seinen neuen Film BLAZE in Locarno. Er erzählt das kurze Leben des Singsongwriters und Countrysängers Blaze Foyle.
Aufmerksame Lucinda Williams Fans kennen ihn aus ihrem Song „Drunken Angel“. Blaze war eng mit dem bekannteren Towns Van Zandt befreundet, der ja jeden ins Grab singen konnte, der noch nicht darin lag. Tatsächlich ist Blaze von dem Sohn eines anderen Freundes 1989 erschossen worden. Da war er erst 40 Jahre alt.
Ich bin auf diesen Film sehr gespannt. Ich gehe davon aus, dass Lieder, die ich sehr mag, darin gespielt werden. In „Oval room“ besingt er die amerikanischen Präsidenten in ihrer Austauschbarkeit. Etwas optimistischer ist der Text von „Clay Pigeons“:
Go down where the people say why’all
Sing a song with a friend change the shape that I m in
And get back in the game and start playin’again …
2018 6 Aug
Gregor Mundt | Filed under: Blog | RSS 2.0 | TB | Comments off
Auch wenn er schon einige Alben herausgebracht hat, für mich war bisher der 29-Jahre junge Gitarrist Daniel Bachman kaum Begriff. Bachman lebt und arbeitet in Fredericksburg, Virginia. Zum Kennenlernen schaue man sich auf YouTube “Daniel Bachman: NPR Music Tiny Desk Concert“ an. Bislang veröffentlichte er Platten, die durchaus an John Fahey, Peter Lang (z.B. die Platte The Thing At The Nursery Room Window) oder Glenn Jones erinnerten, aber bereits 2016 kündigte es sich an. Da kam Bachman mit einer Platte heraus: Daniel Bachman, so auch der Titel, auf der sich die Stücke Brightleaf Blues I und II befinden, besonders mit dem „Brightleaf Blues II“ bahnt sich etwas an, was auf seinem neuesten Werk im Zentrum steht: die Hinwendung zur experimentellen Musik.
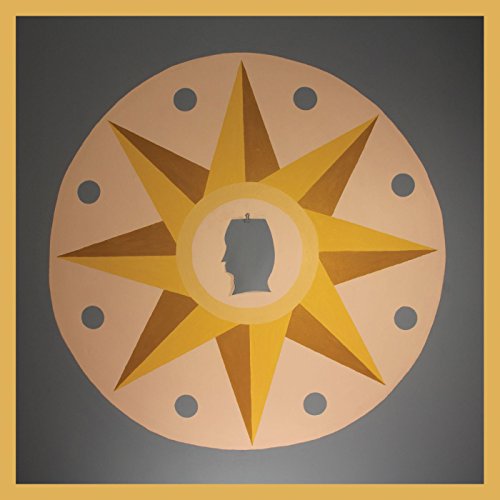
Vor ein paar Tagen erschien sein verstörendes Werk The Morning Star, eine Doppel-LP. Gleich das erste Stück „Invocation“ beansprucht mit achtzehn Minuten eine ganze Plattenseite und der erstaunte Hörer vermisst sogleich die vertrauten Töne des Gitarristen. Konnte man sich zur „Orange County Serenade“ noch eine herrliche Autofahrt Richtung Atlantik (Südfrankreich) vorstellen, sollte man sich diese Musik besser Zuhause auf einer guten Anlage konzentriert anhören: eine Entdeckungsreise beginnt. Glocken, Natur-, Maschinengeräusche, Klangteppiche, man könnte meinen, man hätte sich vertan und eine neue Scheibe aus dem Hause HUBRO MUSIC aufgelegt. Mitnichten: Daniel Bachman – The Morning Star.
Das zweite Stück der Doppel-LP, „Sycamore City“, erinnert stark an Sings Reign Rebuilder vonder Gruppe Set Fire to Flames. Ich stelle mir vor, hier spielt jemand in seinem Wohnzimmer Gitarre, lässt die Fenster geöffnet, sodass die Uher-Vierspur-Bandmaschine alle Nebengeräusche aufnimmt. Immerhin spielt der Meister hier sein ureigenes Instrument. Stück 3: „Car“. Geräusche, eine Radioübertragung von irgendwas, ein Harmonium? Recht traditionell geht es dann bei Song For The Setting Sun III und VI zu, bis zum Ende der letzteren Aufnahme wieder Field-Recordings (aus dem tropischen Regenwald?) eingespielt werden. Ich liebe ja Musik, die in Feldaufnahmen eingebettet, eine ganz eigene Atmosphäre ausstrahlt, so ist es auch bei dieser wunderbaren Platte, bei der die Entdeckungsreise kein Ende nimmt. The Morning Star gehört sicherlich zu den Platten des Jahres 2018.
In einem Kraftakt abends um kurz nach Zehn ist es geschehen: erfolgreich abgeschlossen mit summa cum laude wurde ein Serienmarathon von nicht gekanntem Ausmass. Gut, Trainingseinheiten en masse fanden im Vorfeld statt, Kurse mit Namen Mad Men, Breaking Bad, Sons of Anarchy und manche mehr. Und doch, dies war eine andere Nummer: sechs Staffeln nacheinander, jeden Tag eine Episode, allerhöchstens zwei, insgesamt gut neunzig Stunden Fernsehzeit. Und man braucht „högschte Konzentration“, mit Berieselung war da kein Weiterkommen. Hernach sogleich zum PC gestürzt. Gierig, als sei es eine Nase Koks, ein Stoff, den unsereins ja nie genossen hat, zog ich mir rein, was über Wochen mir versagt war: die Reviews und Kritiken endlich nun zu lesen, Belohnung quasi für Strapazen, die man gerne auf sich nahm. Das, was man sah, emphatisch miterlebte, mit Anderen zu teilen nun. Mehr als beruhigend dann, dass die auch so ihre Probleme hatten: der Schluss der Serie war nah an einer Sonntagspredigt und manche Logik eines Handlungsstranges ging irgendwo verloren. Dem Grundkanon der Rezipienten, dies sei eine grossartige, erzähltechnisch Maßstäbe setzende Fernsehshow, schliesse ich mich an. Die erste Staffel lief im Jahr Zweitausendvier. Damals war im Traum nicht dran zu denken, die Lebenszeit dem Fernsehen zu schenken. Die letzte wurde im Jahr Zweitausendzehn beendet. Meanwhile the televised Revolution has become a quite a familiar place. Findet sich da auch schon ein leichter Abnutzungsprozess, eine leise sich anbahnende Tele-Müdigkeit? Und doch, selbst der durch Zeiten und Leben hindurch wiedergeborene Skeptiker in mir kann sich dem nicht entziehen: frappierend etwa ist die Modernität und Vielfältigkeit der Charaktere. Was sich da aus aller Herren Länder trifft zu einer besonderen Art von Encounter. Allein, was die Drehstandorte betrifft, müssen Unsummen verschlungen worden sein, als seien sie das Opfer einer böse-biestig schwarzen Wolke gewesen. Und richtig, spoke with Wikipedia: allein ein Flugzeugwrack auf eine Insel nach Hawaii zu bringen, kostete locker eine Million. Wie auch bei anderen Serien sind es ja vor allem die detailreichen, tiefenscharfen Zeichnungen der Charaktere. Dass es heute vorrangig Fernsehserien sind und nicht, wie vor Jahrzehnten noch Romane, die imstande sind, Erzählungen von epischem Ausmass vom Stapel zu lassen, das zeigt auch Lost. Grandiose Schauspieler spielen grandiose Figuren: Hugo „Hurley“ Reyes, Kate Austen, Benjamin Linus, John Locke, Jack Sheppard, Jin und Sun Paik, Claire, Michael … Deren aller Stimmen werden mir wohl nach Wochen im Ohr nachklingen wie liebgewonnene Vertraute. Meet you in another life, brother. Dieser ungeheure Kontrastreichtum auch durch die Schnitt-Wechsel von Wildnis und westlicher Zivilisation. Der Wortwitz in den Dialogen. M deutete das neulich an, missing Sawyers humor. Aber auch Jackpotknacker Hurley hat es in sich. Take „rotten“ rockstar Charlie and his Mancunian Slang. Interessant zu lesen, dass Evangeline Lilly, unsere liebe „Kate“, mit genau jenem während der Dreharbeiten eine Relationship hatte (sorry, das wäre die „Frau im Spiegel“, die ich beim Friseur gern läse). Jene Schauspielerin, deren Haus auf Hawaii während der dortigen Dreharbeiten (nun ist es raus, thats the island) abbrannte, sie ihren gesamten Besitz verlor, und überhaupt keine Eile hatte, ihren privaten Lost-Zustand vorschnell zu beenden. Just sideeffects, Marginalien. Das Ende der Serie wurde heftig diskutiert, so lese ich und pflichte bei, finde auch hier meine Wahlverwandten. Einziger Kritikpunkt meinerseits ist und bleibt die Filmmusik. Sie ist gewiss ganz ausgezeichnet und auf den Punkt genau komponiert. Jedes Blatt, das vom Baume fällt, bekommt so ungefähr den passenden melodramatischen Klangabgang. Ben Hur und die Titanic lassen grüssen, oh Graus. Und noch ein Zweites, und hier freue ich mich schon auf Kommendes, nach einer gewissen Rekonvaleszenz: die Stille, das die Einbildungskraft beflügelnde Fast-Nichts im Randgeschehen. Wie in Breaking Bad, wo eine einsame Coladose in der Wüste minutenlang Bände spricht. Man kann nicht Alles haben. Wie sagte jüngst ein gestürzter Radrennfahrer: „Ich weiss noch nicht, wann ich wieder in der Lage bin, aufs Rad zu steigen, brauche erstmal Abstand von der Tour.“ Doch dann gehts weiter, für den einen auf der Giro d´Italia und für den anderen auf dem Sunset Boulevard der neuen Serienwelt: ungedopt, frisch geduscht, geduzt und garantiert nicht ausgebuht.
2018 5 Aug
Jan Reetze | Filed under: Blog | RSS 2.0 | TB | 2 Comments

Mit schätzungsweise 10, also um 1966, habe ich in der Leihbibliothek, die in Hamburg „Bücherhalle“ hieß, Werner Hörnemanns Buch Die gefesselten Gespenster entdeckt.
Die Handlung spielt in einem heißen Sommer kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges in einer Gegend von Marseille, in der nicht die Reichen wohnen. Sieben junge Typen diverser Nationen und Hautfarben schlagen sich durch mit irgendwelchen Jobs, zum Teil auch mit sehr kleiner Kleinkriminalität, und hoffen, es werde irgendwann einmal besser werden. Einer dieser sieben Typen, der hoffnungsvolle, aber bettelarme Kunstmaler Maurice, der von seinem reichen Vater keinen Pfenning will (und der ganz offensichtlich eine Art alter ego des Verfassers ist), findet eines Tages eine Anzeige in der Zeitung: In einem Schloss in Villeneuve treten schwere Spukerscheinungen auf, die gegen saftiges Honorar beseitigt werden sollen.
Ich will jetzt die Geschichte nicht nacherzählen. Ich bin damals kopfüber in sie hineingefallen und habe sie in den Folgejahren noch einige Male wiedergelesen.
Der Autor arbeitet mit einigen karikierenden Klischees, die heute wohl als „rassistisch“ gebrandmarkt würden — Michael Ende hat dieses Phänomen ebenfalls kennengelernt. An keiner Stelle sind diese Schilderungen abwertend gemeint, und ich habe sie auch nie so empfunden. Das Buch ist erstmals 1952 erschienen — da hießen Neger Neger, Chinesen hatten Schlitzaugen und Italiener klauten gern mal. Dabei dachte man sich damals nichts. Der Autor dürfte aus seiner persönlichen Erfahrung geschöpft haben; er hat einige Jahre dort gelebt, wo das Buch spielt, sein Beobachtungsvermögen ist bemerkenswert, und es ist offenkundig, dass er seine Charaktere mit großer Sympathie beschreibt, ihre individuellen Schicksale ebenso wie ihre Irrungen und Wirrungen. Gelegentlich merkt man pädagogische Absichten des Autors allzu deutlich, aber das hat mich damals ebenso wenig gestört wie seine gelegentliche Neigung, flapsige Dialoge um ihrer selbst willen einzubauen.
Ich habe das Buch nie selbst besessen — bis ich es vor einigen Jahren in einer Buchhandlung durch reinen Zufall in einer Neuauflage fand (rechts im Bild). Ich konnte nicht widerstehen und habe das Buch gekauft.
Dieses Gefühl, wenn man merkt, dass nicht mehr das in dem Buch steht, was man erinnert! Dieses Gefühl, wenn man schließlich dahinterkommt, dass man versucht hat, das Buch zu modernisieren! Dialoge sind verändert. Bestimmte, für eine Person typische Begriffe (etwa Renés „Schafsnase!“) tauchen nicht mehr auf. Schlimmer noch: Den Schilderungen fehlt der zeitliche Hintergrund. Vieles, was die Jungs tun, aber auch, was sie in dem Spukschloss entdecken, erklärt sich aus der Zeit, in der die Geschichte spielt. Wenn man das weglässt, schwebt die Story im Raum, etliche Handlungsfäden ergeben keinen Sinn mehr, selbst die (neuen) Zeichnungen funktionieren nicht.
Durch einen weiteren Zufall — ich musste im Postamt eine Adresse aus dem Bonner Telefonbuch heraussuchen (damals musste man das noch, und die Postämter hatten noch alle wichtigen Telefonbücher) — stieß ich um 1995 auf die Adresse des Autors Werner Hörnemann. Ich schickte ihm spontan eine Karte, in der ich ihm mitteilte, wie sehr ich das Buch als Kind geliebt hatte und wie enttäuschend ich die Neuauflage fand. Zwei Tage später rief er mich zu meiner Überraschung an. Er gab mir im wesentlichen recht, sagte aber, er habe keinen Einfluss auf die Gestaltung gehabt. Aus diesem Gespräch weiß ich, dass er tatsächlich in Marseille gelebt hat und dass die Jungs nicht völlig frei erfunden waren. Leider, so sagte er, habe er kein altes Exemplar mehr, sonst würde er mir eines zukommen lassen. (Werner Hörnemann ist 1997 verstorben.)
Es ließ mir keine Ruhe. Bis ich schließlich vor einiger Zeit ein gebrauchtes altes Originalexemplar im Internet gefunden habe (links im Bild) — für, ich glaube, fünf Euronen.
Jetzt stimmt wieder alles. Die Dialoge, die Handlungsfäden, die wunderbaren Zeichnungen von Horst Lemke. Und René sagt endlich wieder „Schafsnase!“