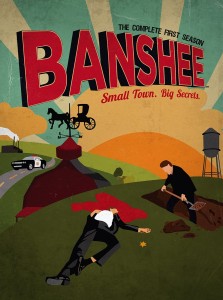Es war noch Frühjahr, anno 1975, die Sonne leuchtete mit satter Wärme jede Fuge meines Zimmers im Studentenwohnheim aus. Der Vorhang war zu dünn, und manchmal wachte ich in ungesunder Wärme mit leichten Kopfschmerzen auf. Heute aber war Vorfreude angesagt. Paul Watzlawick gab sich die Ehre in Würzburg und hielt einen Vortrag im Audi Max. Ich hatte sein Buch „Lösungen“ Monate zuvor in einem alternativen Buch- und Plattenladen erstanden, in einer der verwinkelten Gassen, nahe der Psychologischen Fakultät, als illegale Bindung, und dort auch Dave Liebmans LOOKOUT FARM gekauft, eine seiner zwei ECM-Platten. Rückblickend war die Vorfreude unangemessen, und wie gerne wäre ich mit dezenten Kopfschmerzen im Bett geblieben!
Mein Kumpel Edwin hatte anscheinend keine Zeit, ich nahm Paul Watzlawick nur zu gerne in Augenschein, in späteren Jahren popularisierte er die Ideen des systemischen Denkens der Palo-Alto-Schule, er war ein humorvoller Entertainer, der es verstand, komplexe Sachverhalte sinnlich und anekdotisch zu präsentieren.
Keine grossen Ausflüge jetzt ins Systemische, nur kurz dies: diese neuen Sichtweise auf Konflikte, psychische Störungen, interkulturelle Verhaltensmuster erlauben einen Ausstieg aus irreführenden Stigmatisierungen: oft ist es gerade das „schwarze Schaf“ einer Familie, das eine relative Ordnung aufrechthält, es ist das „schizophrene“ Syndrom, das eine unglückselige, aber kreative Reaktion auf ungesunde „Double Binds“ darstellt.
Konkreter, und simpler: die einstige Auseinandersetzung von John Kelman und mir war kein Beispiel für schlechtes und gutes Benehmen, sondern eine Kette von Missverständnissen, produziert von unterschiedlichen „cultural codes“ für Satire, Glosse, und Beleidigung. Genug der Abschweifung.
Ein warmer Sommertag, Paul W. im Audi Max, in der Woche sahen wir ebendort Werner Herzogs Fata Morgana, und ich bin mir sicher, ich sah demolierte Autos in der amerikanischen Wüste und hörte Leonard Cohen singen. Ein Filmfuchs hielt kleine einführende Vorträge, mit viel Liebe zum Kino, ohne hochtrabendes Geschwätz.
Ich hatte die Süddeutsche Zeitung dabei und blickte an diesem Montagvormittag auf die triste Bundesligatabelle: meine Stadt gab es da nicht, Borussia Dortmund existierte nicht in der Ersten Liga, stattdessen spielte sich Rot-Weiss Essen mit Ente Lippens in die Herzen der Fans. Ein Stich ins Herz, nicht die einzige Begegnung mit der Leere, und existenziellem Schauern, an diesem unblutigen und scheinbar wunderbaren Montag.
Für Essen empfand ich sowieso Sympathie, war ich doch in meiner Kindheit oft bei meiner Grossmutter und Urgrossmutter, und hörte in Essen-Frohnhausen die Symphonie startender Dampflokomotiven. Und es gab den grossen Essen-Roman für die deutsche Kriminalliteratur, Jürgen Lodemanns „Essen, Viehofer Platz, oder Langensiepens Ende“. Wunderbar.

Jetzt, 40 Jahre später, wiederholt sich das Spiel, und das Gespenst des Niemandslands taucht wieder auf: eine unselige Verkettung von Leistungseinbrüchen im Defensivbereich, Viruserkrankungen, neuerlichen Verletzungen sorgt dafür, dass am Wochenende gegen Schalke die wichtigen drei Punkte leider ausbleiben, und die Optimisten mal wieder Lügen gestraft werden.
Ich kehrte ins „Internationale Wohnheim“ zurück, und Edwin klopfte um die Mittagszeit an meine Tür. – Und, sagte er, wer war das denn? – Was meinst du? – Die Frau. Diese total sympathische langhaarige, ehrlich gesagt, total scharfe Frau! Dann erfuhr ich die Details. In meiner 1 1/2-stündigen Abwesenheit war Edwin kurz in mein Zimmer gegangen, ich schloss so gut wie nie ab, um sich „Everybody Knows This Is Nowhere“ zu leihen, und da hätte diese Frau, Anfang 20, auf meinem Bett gesessen, und gefragt, ob dies nicht das Zimmer von Michael sei. Edwin gab Auskunft und sagte, ich würde sicherlich nach der Vorlesung heimkommen. Sie wolle warten, sagte sie, und mein guter alter Freund vergass es, sie wenigstens nach ihrem Namen zu fragen. – Edwin, wie schön war sie? Von 1 bis 10, komm, ehrlich! – Eine glatte 9, Michael, gertenschlank, gebräunte Beine bis zum achten Stock.
Ich blieb den ganzen Nachmittag in meiner Wohnzelle sitzen, hörte Musik, blickte aus dem Fenster, mein Blick fiel auf Watzlawicks Buch „Lösungen“, aber ich fand keine. Sie kam nie wieder. Am liebsten hätte ich, dachte ich viel später, ein Phantombild von ihr zeichnen lassen. Meine Theorie war, dass sie auf der Durchreise war, dass hinter der Erscheinung womöglich die grosse unerfüllte Liebe meiner Tanzstundenzeit steckte, Marlies Durch-den-Wald. Aber wie hätte sie mich ausfindig machen können? War sie eine talentierte Privatdetektivin? Warum ist sie nie wieder gekommen? War sie im Grunde schüchtern, und hat ihren Mut für dieses eine Mal zusammengenommen?
Später, beim Obstwein, hoch über Würzburg, knappe 20 Grad in der Dunkelheit.
– Michael, es tut mir Leid. ich hätte nach dem Namen fragen sollen.
– Was soll’s?
– Michael, ich muss mich korrigieren.
– Ja?
– Eine 10. sie war definitiv eine 10!
– Scheisse.